Lewis Mumford: Mythos der Maschine. Kultur, Technik und Macht. Das Buch beeindruckt auf den ersten Blick und die erste Abwägung durch seine Maße 20 × 26 cm, 856 Seiten, 2,1 Kilogramm. Der zweite Teil der Originalausgabe erschien 1964 und der erste Teil 1966. Der »Anfang« wurde also erst nach dem »Schluss« veröffentlicht. Die 1974 in Wien erschienene deutsche Ausgabe umfasst beide Teile in einem Band. Der Stil des Autors ist allgemein verständlich, ohne jede professorale Wissenschaftler-Prosa.

Im Prolog stellt der Autor Lewis Mumford (1895–1990) seine Forschungsmotivation vor: »In der Terminologie der heute herrschenden Auffassung von der Beziehung des Menschen zur Technik ist unser Zeitalter der Übergang vom primitiven Zustand des Menschen, der durch die Erfindung von Werkzeugen und Waffen zwecks Beherrschung der Naturkräfte gekennzeichnet ist, zu einem radikal anderen Zustand, in dem der Mensch nicht nur die Natur besiegt, sondern sich so weit wie möglich vom organischen Lebensraum abgelöst haben wird. Mit dieser neuen ‹Megatechnik› wird die herrschende Minderheit eine einheitliche, allumfassende, superplanetarische, automatisch funktionierende Struktur schaffen. Anstatt als autonome Persönlichkeit zu handeln, wird der Mensch ein passives, zielloses, von Maschinen abhängiges Tier werden, dessen eigentliche Funktionen nach Ansicht der modernen Techniker der Maschine übertragen oder zum Nutzen entpersonalisierter, kollektiver Organismen strikt eingeschränkt und kontrolliert sein werden.« (S. 13)
Es ehrt Mumford, dass er sich mit der Selbstentmachtung des Menschen nicht abfinden will. Zunächst entwickelt er seine historische Analyse: Der »Anfang der Zivilisation«, vor 4000 Jahren, das »Pyramidenzeitalter«, sei kein Resultat mechanischer Erfindung, sondern das eines radikal neuen Typs sozialer Organisation, ein Produkt aus Mythos, Magie, Religion und entstehenden Wissenschaften gewesen. (S. 23) Dieses »Pyramidenzeitalter«, nicht die industrielle Revolution des 18. Jahrhunderts, sei der Anfang der Organisation einer »archetypischen Maschine«, der »Megamaschine«. (S. 23) Dabei sei von ätzender Symbolik, dass der letzter Zweck dieser Megamaschine der Bau von kolossalen, von Mumien bewohnten Grabstätten war. Dazu kämen die »zivilisierten Greultaten« des Imperiums: verwüstetet Dörfer und Städte, vergifteter Boden. (S. 24)
Hier stellt Mumford eine Verbindung zu seiner Gegenwart her: »Sind denn die großartigen ägyptischen Pyramiden etwas anderes als statische Äquivalente unserer eigenen Weltraumraketen? Diese wie jene sind extrem teure Vorrichtungen, um einer privilegierten Minderheit den Flug in den Himmel zu ermöglichen. Diese kolossalen Missgeburten einer entmenschlichten, machtbezogenen Kultur beschmutzen ständig die Blätter der Geschichte, von der Vernichtung Sumers angefangen bis zur Zerstörung von Warschau, Rotterdam, Tokyo und Hiroshima.« (S. 24) Zusammenfassend rechtfertigt der Autor hier nocheinmal sein umfangreiches Forschungsprojekt: »Diese erweiterte Interpretation der Vergangenheit ist ein notwendiger Schritt, um der traurigen Öde des heutigen, auf eine Generation beschränkten Wissens zu entgehen.« (S. 25)
Im Weiteren arbeitet Mumford seine Sicht auf die Beschänktheit heutigen Wissens weiter heraus. Galileo Galilei ist für den Autor eine Schlüsselfigur in der Beschränkung der Wissenschaft auf bloß quantitative Verfahren und auf eine Wissenschaftswahrheit, im Unterschied zur theologischen Wahrheit. Die Kritik am erstarrten Kirchen-Dogma sei ja noch verständlich. Aber was setzte Galilei an die Stelle des von Thomas von Aquin instrumentalisierten Aristoteles? Galilei greift den Ansatz seines jüngeren Kollegen Kepler auf: Im Unterschied zu den Sinnen ist der Geist geformt, um Quantitäten zu verstehen. Der Geist begreift ein gegebenes Ding um so klarer, in einem quantitativen Verhältnis, je näher es sich auf reine Quantitäten zurückführen lässt. Je weiter sich ein Ding von seinen Quantitäten entfernt, desto mehr Dunkelheit und Irrtum. In seinem Werk »Prüfstein« wiederholt Galilei Keplers Ansatz mit eigenen Worten. »Die Philosophie steht in dem großen Buch, dem Universum, das unserer Betrachtung stets offensteht. Aber man kann das Buch nicht verstehen, wenn man nicht zuerst lernt, die Sprache zu begreifen und die Buchstaben zu lesen, aus denen sie zusammengesetzt ist. Es ist geschrieben in der Sprache der Mathematik, und seine Buchstaben sind Dreiecke, Kreise und andere geometrische Figuren, ohne die es unmöglich ist, auch nur ein einziges Wort davon zu verstehen; ansonsten irrt man in einem dunklen Labyrinth umher.«
In seiner Kritik des erstarrten Kirchen-Dogmas bringt Galilei also ein mechanisches Weltbild hervor. Mechanische Prozesse sind das Leitbild der Forschung. Die Mathematik ist die Ausgangs- und Zentralwissenschaft. Diese methodologische Reduktion beschränkt Wissenschaft auf die Verwendung bloß quantitativer Verfahren und die eingeschränkte Erforschung der unbelebten Natur. Für Mumford ist Galilei, dem er durchaus ein menschliches Privatleben zubilligt, in der Geschichte der Wissenschaft ein Verbrecher. Mit der separaten Wissenschafts-Wahrheit habe dieser die Tür für inhumane Forschungen geöffnet und mit der Beschränkung auf quantitative Verfahren und auf die Maßstäbe der unbelebten Natur für die Erforschung der ganzen Natur die methodologische Beschränktheit der Wissenschaften im Wahn der Naturbeherrschung zementiert. (S. 393 ff) Descartes setzte Galileis Weg fort. Um das zu verdeutlichen, zitiert Mumford eine entscheidende Stelle aus dessen »Abhandlung über die Methode«, in der Descartes betont, er habe erkannt, »dass es möglich ist, zu Kenntnissen zu kommen, die von großem Nutzen für das Leben sind, und statt jener spekulativen Philosophie, die an den Schulen gelehrt wird, eine praktische zu finden, die uns die Kraft und die Wirkungsweise des Feuers, des Wassers, der Luft, der Sterne, der Himmelsmaterie und aller anderen Körper, die uns umgeben, ebenso kennen lehrt, wie wir die verschiedenen Techniken unserer Handwerker kennen, so dass wir sie auf ebendieselbe Weise zu allen Zwecken, für die sie geeignet sind, verwenden und uns so zu Herren und Eigentümern der Natur machen können.« (S. 424) Mumford hebt heraus, dass dieser Beherrschungsanspruch und diese Art des wissenschaftlichen Denkens den einsetzenden Mechanisierungsprozess der Neuzeit begleitete, der zur Herausbildung des »Machtkomplexes«, der »Megamaschine« in Mumfords Gegenwart führten.

Unter der Kapitelüberschrift »Das Paradoxon der Automation« konkretisiert Mumford das Problem: »Unsere Zivilisation hat eine Zauberformel gefunden, um sowohl industrielle als auch akademische Besen und Wasserkübel selbstständig arbeiten zu lassen, in immer größerer Zahl, und mit immer größerer Geschwindigkeit. Aber wir kennen nicht mehr die Formel des Zaubermeisters, die das Tempo dieses Prozesses vermindern oder ihn ganz aufhalten könnte, wenn er einmal aufhört, menschlichen Zwecken und Funktionen zu dienen …« (S. 541) Die Folgen der Automatisation der Wissenschaften erzeugen am Ende nur noch ein Durchschnitts-»Geräusch« (S. 541) »Selbst auf einem eng begrenzten Wissensgebiet … ist es für den gewissenhaften Gelehrten schwierig … mit der Flutwelle rasch verarbeiteten Wissens fertig zu werden. Die Wissenschaft macht den letzten Schritt zur Automation und greift zu neuen, mechanischen Hilfsmitteln, die den Zustand nur verschlimmern. Die Exponenten der Massenproduktion von Wissen haben Hunderte Fachzeitschriften geschaffen, die nur Auszüge aus Abhandlungen drucken und nun wird ein weiterer Auszug aus diesen Auszügen vorgeschlagen.« Dass betrifft alle Wissenschaftsdisziplinen. So groß die Unterschiede zwischen Natur- und Geisteswissenschaften einmal waren, »sie laufen heute nur auf verschiedenen Fließbändern in derselben Fabrik«. Die größten akademischen Institutionen sind so gründlich automatisiert, wie ein Stahlwalzwerk oder ein Telephonsystem. »Die Massenproduktion von wissenschaftlichen Abhandlungen, Entdeckungen, Erfindungen, Patenten, Studenten, Doktoren, Professoren und Publizität … geht ebenso schnell vor sich; und nur jene, die sich mit den Zielen des Machtsystems, wie absurd sie für die Menschen auch sein mögen, identifizieren, haben Aussicht auf Beförderung und große Forschungssubventionen, denn politische Macht und finanzielle Mittel werden denen zugebilligt, die sich systemkonform verhalten.« (S. 542)
Die »Kollateralschäden« bei dieser modernen, automatischen Gewinnung von Wissen sind: eine Unmenge wertvollen Wissens wird, zusammen mit einer noch größeren Menge von Trivialem und Unsinn, auf den Abfallhaufen geworfen, weil es an einer Methode fehlt, die qualitative Maßstäbe anlegt. Mumford fügt an, dass er die praktischen Vorteile, die mit der elektronischen und kybernetischen Technologie verbunden sind, nicht geringschätzen wolle. »Ich will nur sagen, dass die Automation der Automation heute überall dort, wo sie Fuß gefasst hat, nachweislich irrational ist: in den Natur- und Geisteswisssenschaften ebenso, wie in der Industrie und in der Armee. Und ich behaupte, dass dies keine Zufallserscheinung ist, sondern ein Gebrechen, das jedem vollautomatischem System anhaftet.« (S. 543) Bibliothekare spielen hier eine verhängnisvolle Rolle: »Ohne an die Folgen zu denken, spielen viele Bibliothekare heute mit dem verzweifelten Gedanken, die Aufbewahrung von Büchern als veraltet abzuschaffen und deren Inhalt sofort auf Mikrofilm oder Computer zu übertragen. Leider ist ‹Abberufung von Information›, so schnell sie auch gehen mag, kein Ersatz dafür, durch direkten persönlichen Augenschein Wissen zu entdecken, von dessen Existenz man möglicherweise nie gewusst hat, und es mit der eigenen Arbeitsmethode in der einschlägigen Literatur weiterzuverfolgen. … Es geht darum, die menschliche Selektivität und moralische Selbstdisziplin wiederherzustellen …« (S. 544)
Diese Wiederherstellung menschlichen Entscheidungsvermögens ist aber nicht vom »System« zu erwarten, im Gegenteil: »Tatsächlich kann jedoch ein einmal etabliertes automatische System keine menschliche Rückkoppelung akzeptieren, die ein Zurückschalten verlangt; darum akzeptiert es keine Feststellung seiner schädlichen Folgen, und noch weniger ist es bereit, die Notwendigkeit einer Korrektur seiner Postulate zuzugeben. Quantität ist alles. Den Wert seiner rein quantitativen Steigerung als Beitrag zur Erhöhung menschlichen Wohlergehens anzuzweifeln heißt Ketzerei begehn und das System schwächen.« (S. 546) Der Automatischer Apparat, so Mumford, ist so undurchsichtig und unzugänglich wie die Obrigkeit in Kafkas »Schloss«.
Hier verweist Mumford auf den entscheidenden Mangel »automaticher Systeme«: »Die Automation weist … einen qualitativen Mangel auf, der unmittelbar ihrer quantitativen Leistungsfähigkeit entspringt: Kurz gesagt, sie vermehrt die Wahrscheinlichkeiten und vermindert die Möglichkeiten. Obwohl die einzelnen Komponenten eines automatischen Systems programmiert sein kann, wie eine Lochkarte an einem Auto-Fließband … ist das System als solches fixiert und unelastisch – so sehr, dass es kaum mehr ist als ein exaktes mechanisches Modell einer Zwangsneurose und letztlich vielleicht sogar die gleichen Ursachen hat – Angst und Unsicherheit.« (S. 547) Hier findet Mumford eine interessante Formulierung: »Die westliche Gesellschaft hat einen technologischen Imperativ als unanfechtbar akzeptiert, der ebenso willkürlich ist wie das primitivste Tabu: nicht bloß die Pflicht, Erfindungen zu fördern und fortlaufende technologische Neuerungen herbeizuführen, sondern ebenso die Pflicht, sich diesen Neuerungen bedingungslos zu unterwerfen, nur weil sie angeboten werden, ohne Rücksicht auf ihre Folgen für die Menschen.« (S. 548)
Hier formuliert Mumford erstmals alternativem Gedanken: »Es handelt sich um das Problem, Menschen heranzubilden, die ihr eigenes Wesen genügend verstehen, um die Kräfte und Mechanismen, die sie erzeugt haben, kontrollieren und nötigenfalls unterdrücken zu können.« (S. 549) Als für das Verständnis des menschlichen Wesens entscheidenden Unterschied formuliert Mumford: »Offenkundig können Computer keine Symbole erfinden und keine Gedanken begreifen, die nicht bereits in ihrem Programm enthalten sind. Innerhalb dieser engen Grenzen kann ein Computer logische Operationen richtig ausführen und sogar – bei einem Programm, das Zufallsfaktoren einschließt – Kreativität simulieren; unter keinen Umständen kann er von einer anderen Organisationsweise als der seinen auch nur träumen. … Im Gegensatz dazu ist der Mensch seiner Veranlagung nach ein offenes System, das auf ein anderes offenes System, die Natur, reagiert.« (S. 554)
Es dauert lange, bis Mumford seine Alternative etwas auführlicher vorstellt. Erst ab Seite 774 thematisiert er das organischen Weltbild. Er nennt auch einzelne Gewährsleute, zum Beispiel Erasmus Darwin, den Großvater von Charles Darwin, Buffon, Diderot, Lamarck, Goethe, Saint Hilare, Chamber und Herbert Spencer. (S. 776) Aber aus nicht einsehbaren Gründen ist Mumford auf Charles Darwin fixiert. Er stilisiert ihn sogar zum eigentlichen Begründer des organischen Weltbildes: »Im klassischen wissenschaftlichen Denken ist das Ganze aus den Teilen zu erklären, die bewusst isoliert, sorgfältig beobachtet und genau gemessen werden. Aber in Darwins komplementären ökologischen Ansatz ist es das Ganze, das Charakter, Funktion und Zweck des Teiles enthüllt.« (S. 779) Mumford überschätzt Darwin auch hier. Die Deduktion kann die Induktion nicht ersetzen. Spätestens seit Leibniz ist bekannt, dass es darum geht, sich gleichzeitig deduktiv und induktiv dem Gegenstand zu nähern.
In seinem Fazit bringt Mumford sehr unvermittelt die Religiösität ins Spiel: »Um zu ihrer Rettung zu gelangen, wird der Mensch eine Art spontaner religiöser Bekehrung vollziehen müssen: eine Bekehrung vom mechanischen Weltbild zu einem organischen, in welchem die menschliche Persönlichkeit, als die höchst bekannte Erscheinungsform des Lebens, jenen Vorrang erhält, den jetzt Maschinen und Computer haben. … Wenn der Mensch seiner programmierten Selbstvernichtung entkommen soll, dann wird der Gott, der uns schützt, kein deus ex machina sein – er wird in der menschlichen Seele auferstehen.« (S. 807)
Mit diesem Fazit gelingt Mumford eine Wendung, die einer Novelle alle Ehre gemacht hätte, den Leser eines wissenschaftlichen Buches aber etwas verwundert. Religiösität spielte in seiner Argumentation bisher kaum eine Rolle.
Wir finden am Ende des Buches eine umfangreiche, respektable Literaturliste. Vor allem englische und französische Literatur dominiert hier. Auffällig ist, dass zwei US-Wissenschaftler aus Mumfords Vorgängergeneration fehlen: Franz Boas und Edward Saphir. Beide hatten das Erbe der europäischen Geisteswissenschaft in die USA gebracht. Aber selbst Walther Rathenau, der sich in seinem Buch »Von kommenden Dingen« mit der gleichen Problematik wie Mumford befasste, kennt Mumford nicht. So verwundert es nicht, dass auch die europäischen Denker fehlen, die sich mit dem organischen Wesen unseres Universums beschäftigten: Maimonides, Meister Eckhart, Benedikt de Spinoza, Paracelsus, Valentin Weigel, Jakob Böhme, Gotthold Ephraim Lessing, Caspar Friedrich Wolff, Johann Gottfried Herder, die Romantiker u.a.
Herder verwendet, wie Kepler und Galilei, auch das Bild von der Natur als eines »aufgeschlagenen Buches«. Er kommt bei der Lektüre jedoch zu ganz anderen Einsichten: »1. Die ewige Weisheit hat uns ein großes Lehrbuch aufgestellt, daraus wir uns ohne Unterlass unterrichten sollen; dieses heißt die Natur; seine einzelnen Buchstaben sind einzelne Gegenstände. Diese müssen wir zuerst genau, in all ihren Verhältnissen kennen lernen; denn ihre Kenntnis ist der Grund von allem unseren Wissen, welches nicht aus Nebelschlüssen a priori besteht. 2. Zu dieser Erkenntnis dienen uns zuerst die Sinne. Jeder derselben macht uns zu Herren eines eigenen Reiches der Dinge, einer unterstützt, erläutert den anderen. Doch die Sinneseindrücke würden wie Wasserwellen bei uns vorübergehen, ohne Spur zurückzulassen, hätten wir nicht die Sprache um sie zu bezeichnen und festzuhalten. … Wie im Traum gehen dem Tier die äußeren Gegenstände vorüber, weil es keine Bezeichnung für sie hat. Diese Bezeichnung ist unsere Sprache; durch sie rufen wir Gegenstände wieder in uns zurück und sind nun erst fähig, Dinge durch Verbindungen mit anderm Licht zu geben, die für sich allein in ewiger Nacht für uns verhüllt blieben.«
Herder geht im Weiteren davon aus, dass wir uns nach unseren Kräften als ein Ganzes fühlen und überall ein Ganzes suchen. Nach der Behandlung von historischen Ganzen und philosophischen Ganzen bemerkt Herder: »Mathematische Ganze sind unfehlbarer denn die übrigen. 1) Weil sie Ganze, ohne auf Qualität und Zeitmaß Rücksicht zu nehmen, blos von Seiten der Quantität betrachtet, indem sie sich blos mit Flächen und Zahlen beschäftigt. 2) Weil sie durch keine Sprache sich verwirrt, eigentlich blos dem Verstand die Größe zeigt und 3) blos die Regeln der engsten Ordnung, der genauen Aufeinanderfolge beobachtet. Übrigens ist sie nicht über die Philosophie zu setzen, sie beschäftigt sich blos mit Größen, nicht mit Ursache und Wirkung, mit Eigenschaften.« (Herder, Johann Gottfried; Hodegetische Abendvorträge. In: Eichler, Andreas: Gotthilf Heinrich Schubert – ein anderer Humboldt. Niederfrohna 2010., S. 63f) Diese Gedanken Herders, für seinen Sohn Emil und dessen Freund Gotthilf Heinrich Schubert als Hinführung zum Studium gedacht, wurden im Frühjahr 1799 notiert. In dieser Zeit arbeitete Herder an der Kritik der Behauptungen Immanuel Kants, es könne eine »reine Vernunft« ohne Sprache geben und man könne Erkenntnise vor aller Erfahrung gewinnen. Zudem kritisierte Herder Kants »analytisches« Verfahren, mit dem dieser den Wahrheitsanspruch erhob, jedoch nur Folgerichtigkeit nachzuweisen vermochte. Herder nahm in einigen Punkten Mumfords Kritik an der bloß quantitativen »analytischen Philosophie« und anderer Apologeten der verhängnisvollen Wachstums-Politik vorweg.
Mumfords Literaturliste und unsere Ergänzungen sind heute, in einer Zeit, in der sich das Wissen auf den Augenblick der Wahrnehmung von Informationen aus dem Internet beschränkt, erst recht nicht populär. Wir bedürfen aber der Unterstützung dieser wachen Geister, um die Selbstentmachtung, Verblödung und Vertierung der Menschheit etwas entgegensetzen zu können. Die Kehre zum organischen Weltbild ist jedoch nicht zu haben, ohne die Anerkennung der gegenseitigen Bedingtheit der Gegensätze von Vernunft und Glauben. Reine Vernunft macht uns wehrlos gegenüber den Anmaßungen »künstlicher Intelligenz«. Glaube wird ohne Vernunft zum Aberglauben. Menschliche Weisheit ist überhaupt nur auf der Grundlage der sich durchdringenden Gegensätze von Glauben und Vernunft anstrebbar. Doch göttliche Weisheit, das göttliche Wesen, ist auch für den Weisen nicht annähernd vollständig erfassbar. Aber Maimonides, Eckhart, Spinoza, Lessing und Herder verwiesen darauf, dass aus den Wirkungen heraus erfassbar ist, dass Gott die organische Kraft, der Kräfte, das organische Wesen unseres Universums ist, dass beständig vernünftige Strukturen hervorbringt, jedoch nicht reflektiert.
Es geht heute darum, Herrschaftsanmaßungen der »Megamaschine« gegenüber der Natur aufzugeben, die organischen Strukturen des Universums zu begreifen und unseren Platz in der Natur zu finden. Ohne Weisheit wird das nicht gelingen. Demut ist der Anfang der Weisheit (Salomo).

Wir sind Lewis Mumford dankbar, das er uns auf die geistigen und geschichtlichen Grundlagen des für die Menschheit verheerenden »Wachstumszwanges« aufmerksam macht. Die Ironie der Geschichte liegt vielleicht darin, dass die Methode der Megamaschine, die gewaltige Automation des Wissens, nur quantitative Verhältnisse, keine Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge erfassen kann. Resultat dieser aufwändigen Apparatur ist deshalb nur eine abstrakte Verdurchschnittlichung von Wissen.
Mumford nennt die Automation des Wissens das »mechanische Modell einer Zwangsneurose«, die auf Angst, Unkenntnis und Unsicherheit der »Mächtigen« zurückzuführen sei. Doch der psychoanalytische Blick, so interessant er ist, reicht hier nicht aus. Den für die »Wachstumspolitik« verantwortlichen Menschen fehlt es auch an Demut und Sinn für göttliche Weisheit.
Johannes Eichenthal
Information
Nur noch antiquarisch erhältlich: Mumford, Lewis: Mythos der Maschine. Kultur, Technik und Macht. Europa Verlags AG, Wien 1974, ISBN 3-203-50491-X
Noch im Buchhandel oder direkt beim Verlag erhältlich: Eichler, Andreas: Gotthilf Heinrich Schubert – ein anderer Humboldt. Mironde Verlag, Niederfrohna 2010. ISBN 978-3-937654-35-5

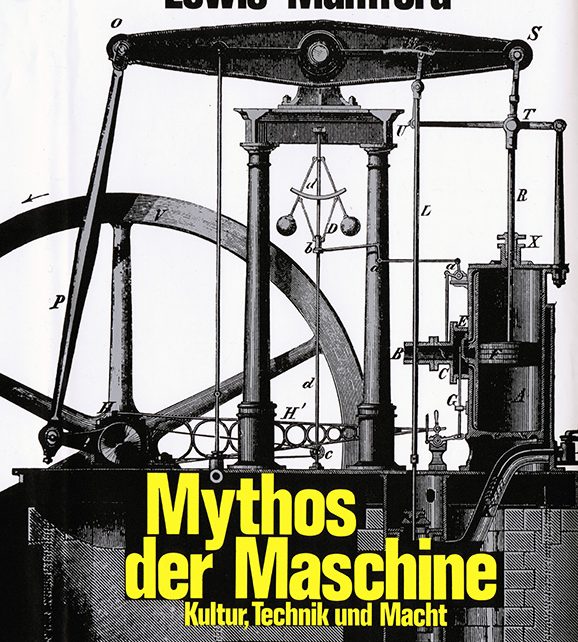
Sehr wertvoll für mich!
Bin bei der Lektüre von Darren Allen’s The Apocalypedia auf den Beitrag gestoßen.
Es braucht die Distanz zum System, um der „… der programmierten Selbstvernichtung …“ zu entkommen,
Nicht-Identifikation, mit anderen Worten.Und für mich ist jeder Hinweis in diese Richtung ermutigend.
Danke!