Am 2. September startete der Mironde-Verlag seine Vorstellungsreihe des dritten Bandes der „Literarischen Wanderung“ nach der Sommerpause, in Hohenstein-Ernstthal, dem Geburtsort Karl Mays, beim einheimischen Geschichtsverein in der Karl-May-Straße. Es hatten sich ein kleiner Kreis Interessierter zusammengefunden. Über die Hälfte waren auswärtige Gäste, darunter auch der epochale Lyriker Ludhardt M. Nebel. Andreas Eichler vom Mironde-Verlag verwies darauf, dass bei der Vorstellung des zweiten Bandes der Wanderung, im Januar 2022, ausführlich auf den berühmten Naturphilosophen Gotthilf Heinrich Schubert (1880–1860) und den Schriftsteller Karl May (1842–1912), die beide aus Hohenstein-Ernstthal stammen, eingegangen wurde. In der heutigen Veranstaltung wolle er den Ethnologen Franz Boas und die Altertumswissenschaftlerin und Roman-Autorin Elisabeth Charlotte Welskopf (Liselotte Welskopf-Henrich) aus der Generationenfolge hervorheben. In etwa 65 Minuten ließ Eichler 800 Jahre sprachlich-literarische Überlieferung an den Zuhörern vorbeiziehen, zeigte Fotos und stellte Zusammenhänge her.

In seinen einführenden Bemerkungen ging er auf den Ethnologen Franz Boas (1858–1942) ein. Der in einer jüdischen Kaufmannsfamilie in Minden geborene Boas studierte sehr vielseitig in Heidelberg, Bonn und Kiel, hier auch „Entdeckungswissenschaften“, wurde von Gustav Karstens 1881 in Kiel mit dem Thema „Beiträge zur Erkenntnis der Farbe des Meerwassers“ promoviert und habilitierte sich 1884 mit dem Thema die „Eisverhältnisse im Nordatlantik“ in Berlin. Die heraufziehende Größenwahn-Atmospähre des politischen Berlin bewirkte, dass Franz Boas 1886 in die USA auswanderte. Hier wurde er 1899 zum Ethnologie-Professor an der Columbia-Universität berufen. Er, und vor allem sein ebenfalls aus Deutschland ausgewanderter jüdische Schüler Edward Sapir (1884–1939), der zu Herders Sprachurspungstheorie und der Herder-Rezeption Jacob Grimms promoviert wurde, wendeten die Forschungsmethoden der Indogermanistik, wie sie in Deutschland zur Erforschung der Sprachgeschichte entwickelt wurden, auf die Erforschung der lebenden Sprachen an der Nordwestküste der USA und Kanadas an. In einem großen Kraftakt dokumentierten Boas und seine Schüler letztlich die Sprachen aller noch lebenden Völker der Ureinwohner. 1911 veröffentlichte Boas das „Handbook of Indian Languages“ in zwei Teilen. 1911 veröffentlichte Boas gleichzeitig ein Buch mit dem Titel „The Mind of Primitiv Man“ (deutsche Übersetzung 1914), in dem er den Geschichts-Ansatz Johann Gottfried Herders (1744–1803) weiterführte. Herder hatte mit dem Bild des Auftauchens und der späteren Überflutung von Hochkulturen aus dem Ozean der Geschichte deutlich gemacht, dass es keine abstrakt-lineare „Logik der Geschichte“ oder eine „Stufenfolge, die alle absolvieren müssen“ geben kann, sondern, dass jede geschichtliche Stufe und jede Form menschlichen Daseins als eine „Naturerzeugung“ aus den konkreten Umständen zu begreifen ist, die einen Selbstwert besitzt.

Elisabeth Charlotte Henrich wurde 1901 in einer Münchener Anwaltsfamilie geboren. In der frühen Jugend las sie die Romane von Cooper, Sealsfield, Gerstäcker, May u.a. Bereits mit 17 Jahren schrieb sie den Entwurf eines Romans über das Schicksal eines jungen Sioux-Dakota von der Stammesgruppe der Teton-Oglala. Nach dem Studium der Alten Geschichte, Rechtswissenschaft, Ökonomie und Philosophie an der Friedrich-Wilhelms-Universitä Berlin wirkte sie bis 1945 als Statistikerin. Während dieser Zeit überarbeitete sie immer wieder am Romanmanuskript, ohne es veröffentlichen zu können. 1946 ging sie die Ehe mit Rudolf Welskopf ein. 1949 wurde ihr eine planmäßige Habilitations-Aspirantur in Alter Geschichte an der Humboldt-Universität angeboten.
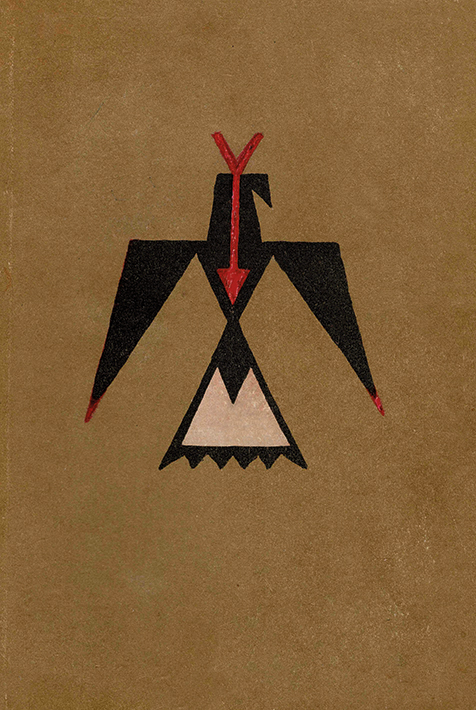
Bedruckter Einbanddeckel der Erstausgabe
1951 konnte sie endlich den Roman „Die Söhne der großen Bärin“ im Altberliner Verlag von Lucie Grosser, unter dem Autoren-Namen „Liselotte Welskopf-Henrich“, in einem Band veröffentlichen. Der Roman wurde später auf drei und auf sechs Bände erweitert. Letztlich erzielte er eine Auflage von sechs Millionen Exemplaren und wurde in zwölf Sprachen übersetzt.

1959 verteidigte Elisabeth Charlotte Welskopf ihre Habilitation mit dem Titel »Die Muße als Problem im Leben und Denken der Helenen von Homer bis Aristoteles« (1962 im Verlag Rütten & Loening in Berlin als »Probleme der Muße im alten Helas“ veröffentlicht.) 1960 wurde sie als Professorin für Alte Geschichte berufen. Erst 1963 ging sie auf Studienreisen nach Kanada und in die USA. Am 19. November 1964 hielt sie, wie es bei der Aufnahme in die Akademie der Wissenschaften üblich war, einen Vortrag mit dem Titel „Die wissenschaftliche Aufgabe des Althistorikers“. Der Text wurde 1965 als Sitzungsbericht der Akademie veröffentlich. Sie war die erste Frau, die als Mitglied der Akademie der Wissenschaften gewählt wurde.
In ihrer Akademie-Aufnahme-Rede von 1964 wird Kritik an der Abstraktheit der dominierenden Geschichtsauffassung deutlich. Karl Marx (1818–1883) führte, trotz aller Kritik, die Fortschritts-Theorie Georg Friedrich Wilhelm Hegels (1770–1831) weiter. Hegel hatte eine aufsteigende Linie der historischen Formation herausgearbeitet. Im preußischen Staat war der „Weltgeist“ aus seiner Sicht an sein Ziel gekommen. Von da ab, so Hegel, werde es zwar noch Ereignisse geben, jedoch keine Geschichte mehr. Die marxistische Interpretation setzte, so Eichler, an die Stelle des preußischen Staates „den Kommunismus“, in dem die Geschichte an ihr Ziel kommen werde. (Hier versäumte es Eichler, vielleicht um nicht noch mehr abzuschweifen, auf den Mitarbeiter des US-Außenministeriums, den Hegelianer Francis Fukuyma, einen Schüler Alexandre Kojevs (1902–1968), zu verweisen, der im Mai 1989 einen Zeitschriftenartikel mit dem Titel „Das Ende der Geschichte“ veröffentlichte. Fukuyama konstatierte richtig den Sieg des Westens im Kalten Krieg und zog dann die hegelianische Schlussfolgerung, dass der Weltgeist nun in den USA an sein Ziel gekommen sei und dass es keine Geschichte mehr gäbe …)
Obwohl Elisabeth Charlotte Welskopf 1966 emeritiert wurde, blieb sie wissenschaftlich und schriftstellerisch aktiv. Hier sei an ihre Herausgeberschaft des vierbändigen Werkes „Geschichte der griechischen Poleis“ erinnert, das 1973/74 im Akademie-Verlag erschien. Sie verstarb 1979. Postum erschien 1981/85 das siebenbändige Werk »Soziale Typenbegriffe“ im Akademie-Verlag, dessen Herausgeberin sie gewesen war.
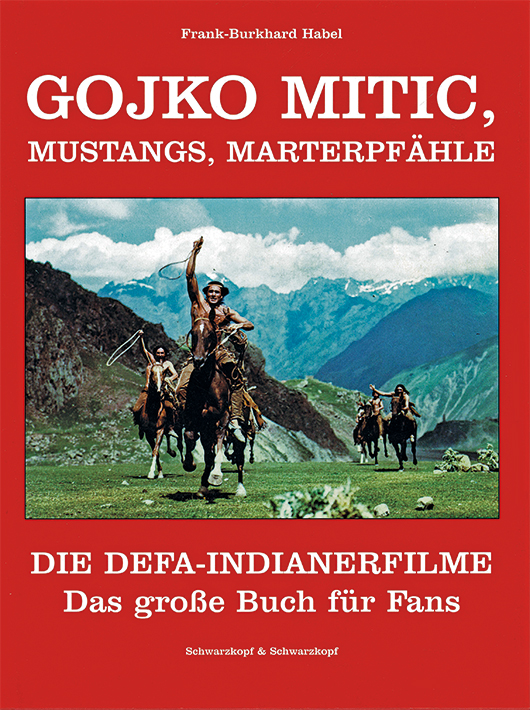
Mit Tokei-ihto hat Liselotte Welskopf-Henrich eine wunderbare Figur geschaffen, und ich hatte das Glück, für kurze Zeit Toke-ihto zu sein. (Gojko Mitić)
Eichler formulierte zusammenfassend, dass der Ursprung der Beschäftigung mit dem Schicksal der amerikanischen Ureinwohner bei Liselotte Welskopf-Henrich in der Lektüre von Romanen zu suchen ist. Er vermutete, das bei der Themenwahl echte christliche Motive beteiligt gewesen sein könnten. So lässt die Autorin ihren Helden Tokei-ihto nach der gelungenen Flucht nach Kanada sagen: „Auch die Tiere sind unsere Brüder, und wir wollen nicht vergessen, mit dem Blütenstaube der Morgendämmerung, mit den Regenwinden und mit den Teichen in grünen Wiesen zu sprechen. Für die starken Wölfe unter den weißen Männern ist alles Land nur Gold und Macht. Wir lieben es, wie eine Schwester.“ (Söhne der großen Bärin, 1951, S. 496) Solche Gedanken, so Eichler, könne man fast wörtlich auch bei Franz von Assisi finden.
In ihrer Schrift über die Muße der Helenen wird deutlich, dass sie den Erzählstil des griechischen Epos sehr gut kennt. So gelang ihr mit dem Roman „Die Söhne der großen Bärin“ tatsächlich ein Epos vom Schicksal der Sioux-Dakota.

Auf dieser Wiese in der Gemeinde Rathen wurde 1965 die Schlussszene des Filmes DIE SÖHNE DER GROSSEN BÄRIN gedreht
Gegen die herrschende abstrakte Geschichtsauffassung, die ihre Gegenwart oder ihre Zielstellung als absoluten Maßstab für die Geschichte betrachtete, brachte Welskopf 1964 einige Einwände vor, die sie als offene Forschungsfragen formulierte. 1977 erschien im Akademie-Verlag Berlin der Band „Weltgeschichte bis zur Herausbildung des Feudalismus“, mit dem Versuch einer korrigierten Formationstheorie, in dem u.a. auf das Problem der Gleichzeitigkeit und Ungleichzeitigkeit eingegangen wurde. Die Autorinnen und Autoren dieser Weltgeschichte danken auch Elisabeth Charlotte Welskopf für ihre Hinweise. Die Verteidigung der Existenz der Sioux-Dakota-Kultur, so Eichler, ist aber auch mit der Überarbeitung von 1977 nicht möglich. Es ist eine Illusion zu glauben, dass sich das Universale, das Allgemeine der Menschheitsgeschichte in einer einzigen Kultur manifestieren könne. Das Allgemeine existiert, nicht „rein“ oder „an sich“, sondern nur als innerer Zusammenhang aller besonderen Kulturen: „In ihrer Besonderheit“, sagte Franz Boas, „sind alle Kulturen annähernd gleichwertig“. Johann Gottfried Herder, Franz Boas, Wilhelm Ditltey (1884–1939), Ricarda Huch (1864–1947), Walther Rathenau (1867–1922) Hans Freyer (1887–1969), Fernand Braudel (1902–1985), Marshall Sahlins (1930–2021) u.a. erarbeiten Methodensysteme, mit dem es uns möglich ist, die Menschheitsgeschichte zu begreifen. Diese Offenheit ist jedoch auch notwendig. Denn, so formulierte es Eberhard Görner im Geleitwort zum dritten Band der Literarischen Wanderung: „Unsere Bildung zur Humanität ist ohne die Verteidigung der Kultur der Sioux-Dakota nicht möglich.“

Gedenkstein für den Film DIE SÖHNE DER GROßEN BÄRIN auf der Rathener Wiese
Was bleibt? Liselotte Welskopf-Henrich hatte 1965 das Drehbuch für einen geplanten Film „Die Söhne der großen Bärin verfasst. Das Drehbuch wurde vom Regisseur verändert. Das war nicht schön, jedoch in der Branche üblich. Der Film konnte die Vielschichtigkeit und Komplexität des Romans nicht vollständig übernehmen. Vielleicht war es dem jungen Hauptdarsteller Gojko Mitić (Jg. 1940) zu verdanken, dass dieser Film dennoch ein großer Erfolg wurde. Die Schlussszene des Filmes wurde 1965 auf dieser Wiese in der sächsischen Gemeinde Rathen gedreht.
Johannes Eichenthal
Information
Andreas Eichler: Literarische Wanderung durch Mitteldeutschland. Sprache und Eigensinn 3. Von Thomas Mann bis Gundermann: https://buchversand.mironde.com/p/andreas-eichler-literarische-wanderung-durch-mitteldeutschland-t-3-von-thomas-mann-bis-gundermann
Andreas Eichler: Literarische Wanderung durch Mitteldeutschland: Teil 1 bis 3: https://buchversand.mironde.com/p/eichler-literarische-wanderung-durch-mitteldeutschland-teil-1-3
Die Litterata – Technik und Poesie in Mitteleuropa – ist ein Feuilleton des Mironde Verlags (www.mironde.com) und des Freundeskreises Gert Hofmann.
Einladungen zu kommenden Vorstellungen der Literarischen Wanderung


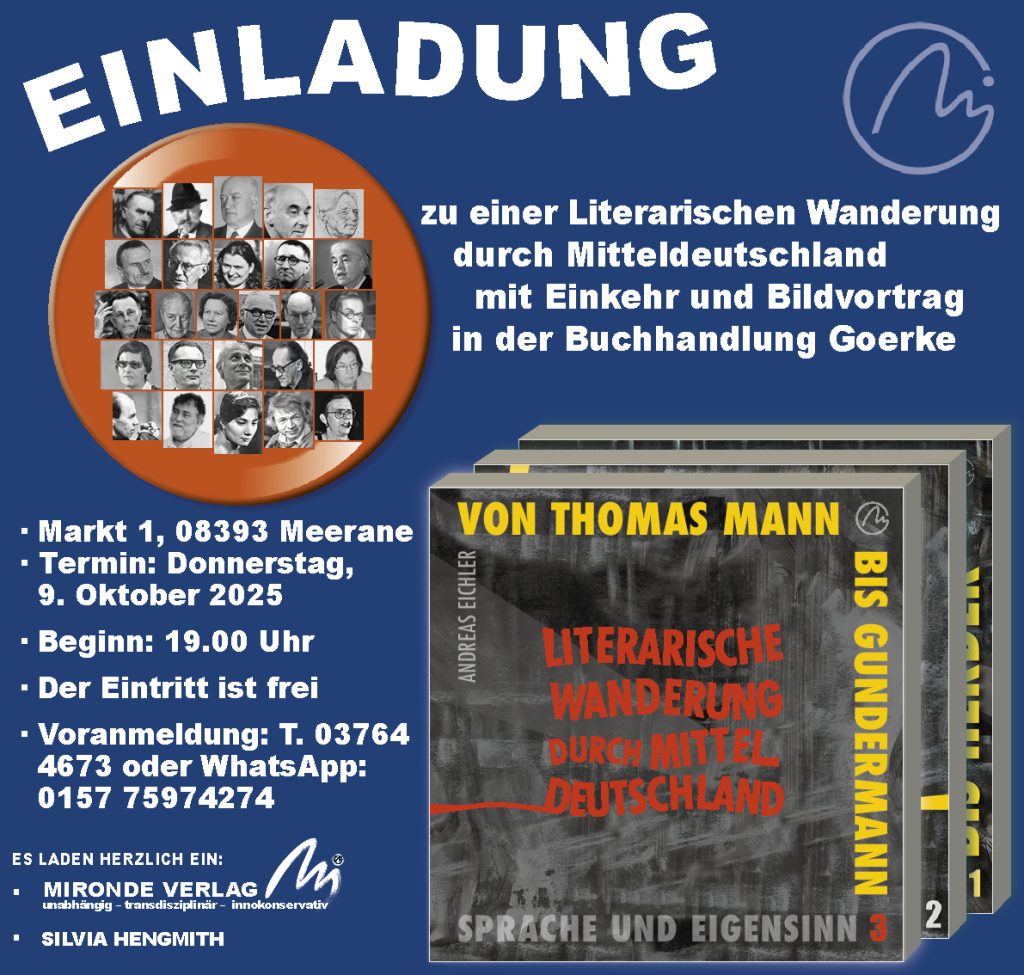

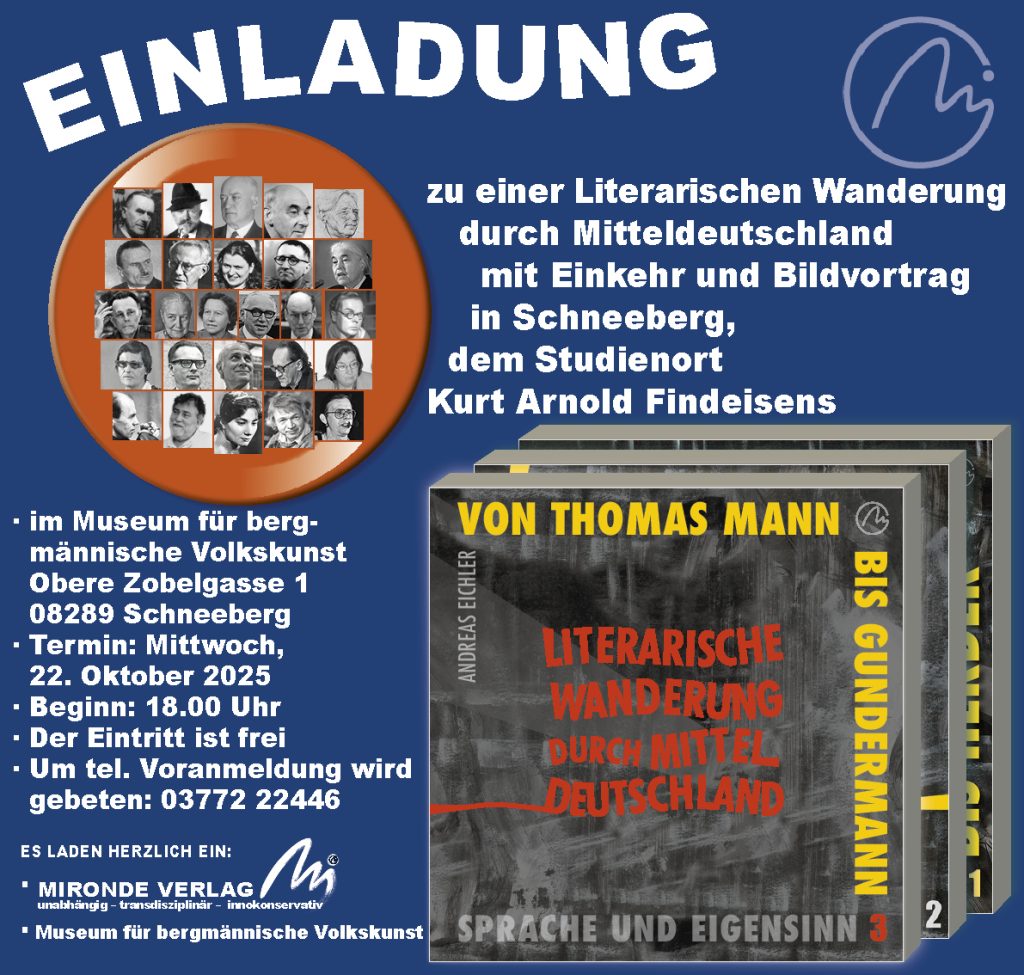



Um es gleich vorweg zu nehmen, der Ritt nach Hohenstein-Ernstthal lohnte! Detailliert und ausgestattet mit einen unglaublichen Wissensfundus beleuchtete der Autor Dr. Andreas Eichler das literarisch-wissenschaftliche Leben der Protagonisten dieses dritten Bandes der „Wanderung durch Mitteldeutschland“. Wobei die vorgestellten Literaten, Wissenschaftler und Philosophen nicht zwangsläufig aus der Region stammen müssen, aber ihre Wirkungsstätten wenigstens temporär hier hatten. Der studierte Philosoph Eichler erklärte, auch für Laien nachvollziehbar, anschaulich und immer interessant Zusammenhänge zwischen den Leben und der Arbeit der 26 vorgestellten Literatinnen und Literaten. Schwerpunkt war die Autorin Liselotte Welskopf-Henrich, deren Bücher ich als Jugendlicher regelrecht verschlang und zeitweise Jagd nach ihren Büchern, Kinoprogrammen zum Thema und anderen Indianerbüchern machte. Dank des spannenden Vortrages erfuhr ich völlig unbekanntes über die Autorin und freue mich auf die Lektüre des Bandes.
Eine Buchvorstellung in Groß-Mützenau ist 2025 fest eingeplant.
Sehr geehrter Herr Eichler, ich danke Ihnen vielmals für diesen interessanten Ausflug in die Geschichte – in die Geschichte auch Nordamerikas und in die Geschichte der „Söhne der Grossen Bären“! Die konkreten Orte in Sachsen mit der Weltgeschichte zu verbinden, haben Sie großartig gelöst. Ich hätte gerne Ihre Zustimmung, den Artikel auf der u.g. Website und bei mir auf facebook zu verlinken.