Vor 16 Jahren kam es in München zu einer Diskussion zwischen dem emeritierten Soziologie- und Philosophie-Professor Jürgen Habermas und Joseph Kardinal Ratzinger vor geladenen Gästen. Im Januar 2005 veröffentlichte Joseph Kardinal Ratzinger den Wortlaut seiner Grundsatzerklärung in einer Aufsatzsammlung »Werte in Zeiten des Umbruchs. Die Herausforderungen der Zukunft bestehen.« Die Grundsatzerklärung von Jürgen Habermas wurde ebenfalls 2005 veröffentlicht. Weil es damals um die Frage der Zukunftsfähigkeit ging, wollen wir an die Veröffentlichung dieser Texte im Rückblick erinnern.
(Von der Diskussion selbst sind uns leider keine Publikationen bekannt.)

Zur Diskussion stand damals die für Nichtjuristen etwas unverständliche Frage, ob der »freiheitliche Staat vorpolitischer moralischer Grundlagen« bedürfe. Aufgeworfen hatte diese Fragestellung Mitte der 1960er Jahre der Verfassungsrechtler Ernst W. Böckenförde.
(Das Wort »vor-politisch« symbolisiert eine Art Bruch der Gegenwart, der »Moderne«, mit der Geschichte.)
Professor Habermas spricht als Erster. Er verändert die Fragestellung leicht. Sein Beitrag ist überschrieben mit »Vorpolitische Grundlagen des demokratischen Rechtsstaates?« (In: Habermas, Jürgen: Zwischen Naturalismus und Religion. Suhrkamp Verlag. Frankfurt 2005, S. 106) Zunächst bekennt sich Habermas zum »Republikanismus« Immanuel Kants. Dann beschreibt Habermas seine Ausgangsposition: »Der politische Liberalismus versteht sich als eine nichtreligiöse und nachmetaphysische Rechtfertigung normativer Grundlagen des demokratischen Verfassungsstaates. Diese Theorie steht in der Tradition eines Vernunftrechts, das auf die starken kosmologischen oder heilsgeschichtlichen Annahmen der klassischen und religiösen Naturrechtslehre verzichtet.« (S. 107)
(Auffällig sind hier die Zuschreibungen »nicht-religiös« und »nach-metaphysisch«.)
Habermas »spezifiziert« seine Argumentation beständig: »Wenn man … das demokratische Verfahren … als eine Methode zur Erzeugung von Legitimität aus Legalität begreift, entsteht kein Geltungsdefizit, das durch ‹Sittlichkeit› ausgefüllt werden müsste.« (S. 109)
Eigentlich ist hier schon die eingangs gestellte Frage beantwortet: Aber, so räumt Habermas ein, »politischer« Grundlagen bedarf dieser Staat durchaus. Als Mittel zur Herausbildung der »republikanischen Gesinnungen«, des »Verfassungspatriotismus«, nennt Habermas die Methode der »Gedächtnispolitik«. An dieser Stelle räumt Habermas ein, dass sein Gedankenkonstrukt von »externen Gründen« bedroht wird, z.B. von dem »Abbröckeln staatsbürgerlicher Solidarität«, dem Einfluss »der Märkte« und der »fragmentierten Weltgesellschaft«. (S. 116) Gleichzeitig hofft er auf den Prozess der »Verrechtlichung« (S. 108) und geht von der Existenz einer supranationalen Einheit, einer »universalistischen Rechtsordnung« aus. (S. 117)
Eher wie nebenbei macht Habermas deutlich, dass die »kommunikative Vernunft« (S. 113) keinen Dialog mit Religion und Glaube anstrebe. Konsequent stellt er dem »Glauben« das »Wissen« gegenüber, nicht die Vernunft. (S. 118) Dadurch wird deutlich, dass er »Glauben« allein mit den Kriterien des »Wissens« beurteilt und dass die »kommunikative Vernunft« keinen Dialog mit dem (vor-wissenschaftlichen, vor-modernen) Glauben leisten könne oder wolle. Habermas‘ Vorurteile gegenüber Glauben und Religion werden in folgender Passage nocheinmal konzentriert deutlich: »So trifft das Theorem, dass einer zerknirrschten Moderne nur noch die religiöse Ausrichtung auf einen transzendenten Bezugspunkt aus der Sackgasse verhelfen könne, auch heute wieder auf Resonanz. In Teheran fragte mich ein Kollege, ob nicht aus kulturvergleichender Sicht die europäische Säkularisierung der eigentliche Sonderweg sei, der einer Korrektur bedürfe.«
Allein die Fragestellung ist Habermas suspekt. Statt einer Antwort fügt er unvermittelt an, dass er bei dieser Frage an die Stimmungslage der Weimarer Republik und Carl Schmitt, Heidegger oder Leo Strauss erinnert worden sei, verzichtet aber auf Gründe. (S. 113)
Am Ende fasst Habermas in seiner Fachsprachen-Manier zusammen: »Aufgrund … (der) Erfahrungen der säkularisierenden Einbindung religiös verkapselter Bedeutungspotentiale können wir dem Böckenförde-Theorem einen unverfänglichen Sinn geben.« (S. 116)
Für Habermas hat der »demokratische Rechtsstaat« keine vor-politischen und vor-wissenschaftlichen Voraussetzungen, wie den Glauben, nötig.

Kardinal Ratzinger überschreibt seinen Diskussionsbeitrag »Was die Welt zusammenhält. Vorpolitische moralische Grundlagen eines freiheitlichen Staates.« (In: Ratzinger, Joseph Kardinal: Werte in Zeiten des Umbruchs. Herder Verlag 2005, S. 28) Mit wenigen Worten skizziert er die durch Beschleunigung geprägte Herausbildung gegenseitiger Abhängigkeiten und gleichzeitiger Konflikte der Weltgesellschaft. Kulturen und Religionen seien heute durch Nichteinheitlichkeit und innere Spannungen geprägt.
Daran fügt er die Frage an: »Wie können die sich begegnenden Kulturen ethische Grundlagen finden, die ihr Miteinander auf den rechten Weg führen und eine gemeinsame rechtlich verantwortete Gestalt der Bändigung und Ordnung der Macht aufbauen?« (S. 28)
Zunächst geht Ratzinger auf das Projekt »Weltethos« des von ihm geschätzten Hans Küng ein. In diesem wurde versucht, ein grundlegendes ethisches Ideal zu erfinden. Es vermochte aber keine Antworten auf drängende Fragen zu geben: »Im Prozess der Begegnung und Durchdringung der Kulturen sind ethische Gewissheiten weithin zerbrochen, die bisher tragend waren. Die Frage, was nun eigentlich, zumal in dem gegebenen Kontext, das Gute sei, und warum man es, auch selbst zum eigenen Schaden, tun müsse, diese Grundfrage steht weithin ohne Antwort da.« (S. 29)
Klar sei dagegen, so Ratzinger, dass die Wissenschaften ein solches Ethos nicht hervorbringen können, da sie selbst wesentlich am Zerbrechen der moralischen Gewissheiten beteiligt seien.
Dafür komme, so Ratzinger, der Philosophie die Verantwortung zu, um den Blick auf das Ganze, auf die weiteren Dimensionen der Wirklichkeit des Menschseins offen zu halten, von dem sich in der Wissenschaft immer nur Teilaspekte zeigen können. (S. 29)
Zunächst beschreibt Ratzinger die »Pathologie der Religion«, besonders den religiös begründeten Terror, und stellt die Frage, ob Religion eine heilende und rettende oder eine archaisch-gefährliche Macht sei, die unter Aufsicht der Vernunft gestellt werden müsse. Aber selbst, wenn man die Religion unter die Aufsicht der Vernunft stelle, bleibe die Frage: »Ist die allmähliche Auflösung der Religion, ihre Überwindung, als nötiger Fortschritt der Menschheit anzusehen, damit sie auf dem Weg der Freiheit und der universellen Toleranz kommt, oder nicht?«
Statt einer Antwort verweist er zunächst auf die gleichzeitig existierende »Pathologie der Vernunft«. Am Beispiel der »Schöpfungsphantasien« von Gentechnik-Wissenschaftlern und der Entwicklung der Atombombe stellt er die Frage, ob nicht die Vernunft unter Aufsicht gestellt werden sollte.
An diese prägnante Beschreibung der wesentlichen Gegensätze schließt er seinen Vermittlungsvorschlag an: Vielleicht sollten sich Religion und Vernunft gegenseitig begrenzen und in die Schranken weisen?
(Damit bringt Ratzinger den Platonischen Begriff der Selbstbeschränkung – »Sophrosyne« – in das Gespräch ein.) Schritt für Schritt versucht Ratzinger dann die gegensätzliche Bedingtheit von Glauben und Vernunft zu konkretisieren, um eine Vermittlung der Gegensätze denkbar zu machen.
Nach einem historischen Exkurs in die Geschichte des Naturrechts formuliert Ratzinger wieder eine Frage: »Als letztes Element des Naturrechts, das im Tiefsten ein Vernunftrecht sein wollte, jedenfalls in der Neuzeit, sind die Menschenrechte stehen geblieben. Sie sind nicht verständlich ohne die Voraussetzung, dass der Mensch als Mensch, einfach durch seine Zugehörigkeit zur Spezies Mensch, Subjekt von Rechten ist, dass sein Sein selbst Werte und Normen in sich trägt, die zu finden, aber nicht zu erfinden sind. Vielleicht müsste heute die Lehre von den Menschenrechten um eine Lehre von den Menschenpflichten und von den Grenzen des Menschen ergänzt werden, und das könnte nun doch die Frage erneuern helfen, ob es nicht eine Vernunft der Natur und so ein Vernunftrecht für den Menschen und sein Stehen in der Welt geben könnte.«
(Gibt es eine Vernunft der Natur? Liegen Werte und Normen des Menschen in seinem Dasein verborgen und müssen ge-funden und nicht er-funden werden?)
Typisch für Ratzinger ist, dass er für die Lösung der heutigen Probleme kein abstraktes Vereinheitlichungs-Ideal erfindet, sondern das Gespräch zwischen den Nationen, Religionen und Kulturen als Weg zur Vermittlung der Gegensätze vorschlägt: »Ein solches Gespräch müsste heute interkulturell ausgelegt und angelegt werden. Für Christen hätte es mit der Schöpfung und dem Schöpfer zu tun. In der indischen Welt entspräche dem der Begriff des Dharma, der inneren Gesetzlichkeit des Seins, in der chinesischen Überlieferung der Idee der Ordnung des Himmels.« (S. 36)
Die Anerkennung der faktischen Nichtuniversalität der westlichen Kultur und des Christentums sei eine grundlegende Voraussetzung für das Zustandekommen der interkulturellen Gespräche. Der Westen und das Christentum seien allerdings immer noch die mächtigsten Akteure in der Weltpolitik.
An diesem Punkt geht Ratzinger vorsichtig auf das Unverständnis seines Diskussionspartners ein: »Insofern scheint mir die Frage des Teheraner Kollegen, die Jürgen Habermas erwähnt hat, doch von einigem Gewicht zu sein, die Frage nämlich, ob nicht aus kulturvergleichender und religionssoziologischer Sicht die europäische Säkularisierung ein Sonderweg sei, der einer Korrektur bedürfe.«
Die Zukunftsfähigkeit kann nicht durch einseitige Erfindung abstrakter Vereinheitlichungs-Normen erlangt werden: »Mit anderen Worten, die rationale oder die ethische oder die religiöse Weltformel, auf die alle sich einigen, und die dann das Ganze tragen könnte, gibt es nicht … deswegen bleibt auch das sogenannte Weltethos eine Abstraktion.« (S. 38)
(Ratzinger beschränkt seine Kritik auf Hans Küng, obwohl er auch die Abstraktionen Habermas‘ trifft.)
Ratzinger ordnet seine Argumentation völlig der Verständigung unter. So thematisiert er gegenüber seinem Gesprächspartner nicht den grundlegenden Dissens im Verständnis von Philosophie.
Habermas geht von einer eng gefassten Vorstellung von Aufklärung und Vernunft aus. Daran ändert auch die Zuschreibung »kommunikative Vernunft« nichts.
Ratzinger folgt dagegen einer jahrtausendealten Tradition der Bestimmung von Philosophie als »Liebe zur Weisheit«, »Weisheit« zudem als Korrelationalität der Gegensätze von Glauben und Vernunft.
Ähnlich einem Arzt geht Ratzinger streng von der Diagnose aus: es gäbe eine Pathologie der Religion und eine Pathologie der Vernunft: »Ich würde demgemäß von einer notwendigen Korrelationalität von Vernunft und Glauben, von Vernunft und Religion sprechen, die zu gegenseitiger Reinigung und Heilung berufen sind und die sich gegenseitig brauchen und das gegenseitig anerkennen.« (S. 39)
In Bezug auf die Konsequenzen fügt er hinzu, obwohl die westliche Rationalität und das Christentum in der Weltpolitik immer noch die wichtigsten Kräfte wären, sei es wichtig, die anderen Kulturen und Religionen »in den Versuch einer polyphonen Komplementarität hineinzunehmen, in der sie sich selbst der wesentlichen Komplementarität von Vernunft und Glauben öffnen, so dass ein universaler Prozess der Reinigung wachsen kann, in dem letztlich die von allen Menschen irgendwie gekannten oder geahnten wesentlichen Werte und Normen neue Leuchtkraft gewinnen können, so dass wieder zu wirksamer Kraft in der Menschheit kommen kann, was die Welt zusammenhält.« (S. 40)

Kommentar
Allein das Zustandekommen einer Diskussion zwischen dem Professor Jürgen Habermas und Joseph Kardinal Ratzinger war im Jahre 2004 eine Sensation, denn echte Diskussionen kamen bereits damals in der Wissenschaftswelt kaum noch vor.
Habermas gehörte nach 1990, im Fahrwasser von Francis Fukuyamas hegelianischem »Ende der Geschichte«, zu den »Begründern« einer Vorreiterrolle des Westens in der Welt mittels Selbstermächtigung zur Universalität. Der Westen sei dort, wo die anderen noch hin müssten. Allen nichtwestlichen Gesellschaften bescheinigte er nur noch zu einer »nachholenden Revolutionen« fähig zu sein.
In seiner Laudatio auf die Verleihung des »Friedenspreises des Deutschen Buchhandels« an Jürgen Habermas sagte Jan Philipp Reemtsma im Oktober 2001, das Habermas »der« Philosoph »der« Bundesrepublik Deutschland sei. (Reemtsma, Jan Philipp: Laudatio. In: Habermas, Jürgen: Glauben und Wissen. Suhrkamp Verlag, Frankfurt 2001, S. 35)
Insofern kommt der Diskussion von 2004 eine besondere Bedeutung zu. Kennzeichnend für die unterschiedlichen Diskussionsstile ist, dass Habermas seine Auffassung des bereits eng gefassten Themas streng »spezifiziert« und dabei zahlreiche Wortneubildungen benutzt. Für einen Laien ist es schwer, diesem professoralen Jargon zu folgen.
Ratzinger geht dagegen von den offensichtlichen Problemen der heutigen Weltgesellschaft aus und stellt viele Fragen. Im Unterschied zu Habermas betont er auch die Punkte der Übereinstimmung mit dem Gesprächspartner (Beschreibung der säkularen Gesellschaft). Die Kritik an Habermas‘ Ausgangspunkt mildert er mit einer Weltethos-Kritik ab. Doch die Kritik an der Abstraktion eines »Weltethos« trifft auch den Habermasschen Ausgangspunkt. Das Allgemeine ist immer nur der innere Zusammenhang des Besonderen. Man kann die abstrakt-allgemeine Vorstellung einer »universellen Rechtsordnung« nach westlichem Muster konstruieren, doch die westliche Rationalität und die westliche Kultur können nicht das »Allgemeine«, nicht das »Universelle« verkörpern, denn Allgemeines und Universelles können nicht »an sich«, nicht in reiner Form existieren. Alle Kulturen haben neben besonderen auch allgemeine Züge, doch das Allgemeine »an sich« gibt es in unserer Welt nicht.
Ratzinger hebt als Alternative zur Vereinheitlichung unter abstrakte Rechtsnormen den Weg des inter-kulturellen Gesprächs und der inter-kulturellen Zusammenarbeit für die Suche nach »dem Allgemeinen« hervor, das den Reichtum des Besonderen bewahrt. Im Gespräch kann die vielstimmige Abhängigkeit aller Religionen und Kulturen voneinander bewusst werden. In der Zusammenarbeit kann Vertrauen entstehen. Joseph Kardinal Ratzinger macht deutlich, dass auf keinen Fall eingegriffen werden darf. Nur die Religionen und Kulturen selbst können sich dem Gedanken der gegensätzlichen Bedingtheit von Glauben und Vernunft öffnen.
(Vielleicht wird sich in einem solchen Gespräch sogar herausstellen, dass die Trennung von Glauben und Vernunft, der Verzicht auf die Tradition von Weisheit, tatsächlich eine westliche Besonderheit, und dass die Weisheitstradition für die Kulturen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas eher selbstverständlich ist?)
In alter Weisheits-Tradition macht uns Joseph Kardinal Ratzinger deutlich, dass es keine vor- und keine nachmetaphysische, keine vor- und keine postmoderne, keine linke und keine rechte, keine liberale und keine illiberale Philosophie geben kann. In der Tradition Nikolaus von Kues, der mit seiner Schrift »Friede im Glauben« nach der Besetzung Konstantinopels durch die Osmanen im Jahre 1453 gegen vorherrschende Kreuzzug-Reflexe das Gespräch der Religionen zur Konfliktlösung vorschlug, erinnert er uns daran: Philosophie ist das ewige und immer wieder neue Streben nach Weisheit.
Vor 200 Jahren waren solche Gedanken schon einmal Allgemeingut. Der damalige protestantische Generalsuperintendent von Weimar hatte 1799 gegen Immanuel Kant eine »Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft« veröffentlicht, in der er darauf verwies, dass es keine »reine Vernunft« geben kann. In der Zeitschrift »Adrastea« verwies Johann Gottfried Herder auf die Weisheit als Verständigungsgrundlage: »Mithin sind, so verschieden sie vorgetragen wurden, alle sogenannten ersten Grundsätze der Sittlichkeit Eins und Dasselbe. So wenig es mehrere Vernünfte im Menschengeschlecht geben kann, so wenig sind mehrere höchste Prinzipien der Sittlichkeit auch nur denkbar. Plato und Aristoteles, Demokrit und Zeno, unter den neueren Clark und Wollaston, Smith, Ferguson, Leibniz und Spinoza sagen im Grunde Ein und Dasselbe; Jeder sagt es nach seiner Ansicht der Dinge und inneren Lebensweise. Dieser dunkler, jener klarer, bestimmter, unbestimmter, enger, weiter.« (Herder, Johann Gottfried. Adrastea. Frankfurter Werke Ausgabe in zehn Bänden. Bd. 10, Hrsg. Günter Arnold. Frankfurt 2000, S. 140/41)
Für Herder gab es die Erbschaft der Weisheit aller Völker, Kulturen und Religionen. In der allgemeinen Menschheitskultur müssen die Besonderheiten der Völker bewahrt werden können. In den besonderen Erzählungen müssen die allgemeinen Erfahrungen der Einordnung des Menschen in die Vernunft der Natur, in die kosmische Vernunft, in die göttliche Vernunft beständig, wieder gefunden und in unsere Tradition aufgenommen werden. Vernunft ist unsere Fähigkeit aus Fehlern zu lernen. Glaube ist die Hoffnung, dass wir zur Teilhabe an der natürlichen, der kosmischen, der göttlichen Vernunft fähig sind.
Die Grundpositionen Joseph Kardinal Ratzingers und die des Weimarer Generalsuperintendenten Herder sind sich sehr nahe. Das lässt uns hoffen. Diese Hoffnung haben wir aber auch nötig, denn die von Joseph Kardinal Ratzinger angeregten Gespräche der großen Weltreligionen waren bis heute nicht im angemessenen Rahmen erfolgreich. Ein Friede im Glauben ist nicht in Sicht. Der wäre aber heute notwendiger denn je, um drängende Probleme lösen zu können.
Aus der zeitlichen Distanz wird der Beitrag Joseph Kardinal Ratzingers noch interessanter. Die »Verrechtlichung« der Welt nach westlichem Muster kann keine Lösung heutiger Probleme leisten. Das Resultat der »okzidentalen Rationalität«, der instrumentalisierten Vernunft, die Wegwerf-Konsum-Gesellschaft, ist ja gerade das Problem unseres heutigen Verhältnisses zur Natur. Diese Macht des Wegwerf-Konsums konnte mit internen Regularien der Verrechtlichung bisher nicht »gebändigt« werden. Ist es deshalb nicht sinnvoll, dem Vorschlag Ratzingers nach einer gegenseitigen Anerkennung und Begrenzung von Vernunft und Glauben zu folgen? Der Friede im Glauben ist die Voraussetzung zur Lösung aller anderen heutigen Probleme. In einer von religiösen, sozialen, wirtschaftlichen und militärischen Konflikte beherrschten Welt ist an die Lösung ökologischer Probleme nicht zu denken. Wir brauchen die Hoffnung, den Glauben, dass wir der Vernunft der Natur teilhaftig werden können, um bewusst als Teil der Natur leben zu können. Ein einfaches Leben im inneren Frieden kann besser sein als das Haschen nach »Wegwerf-Konsum-Wind«.
Johannes Eichenthal
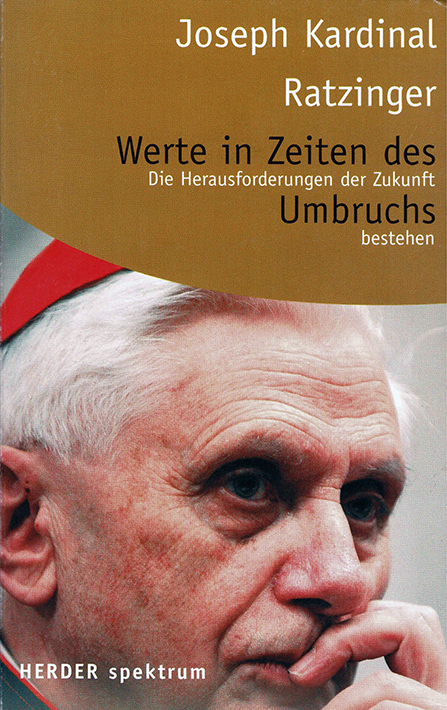
Information
Habermas, Jürgen: Zwischen Naturalismus und Religion. Suhrkamp Verlag. Frankfurt 2005
ISBN 978-3-518-58447-7
Ratzinger, Joseph Kardinal: Werte in Zeiten des Umbruchs. Herder Verlag, Freiburg 2005
ISBN 978-3-451-05592-8
Beide Diskussionsbeiträge in einem Band:
Jürgen Habermas/Joseph Ratzinger: Dialektik der Säkularisierung. Über Vernunft und Religion. Herder Verlag, Freiburg 2018
ISBN 978-3-451-03119-9
Die Litterata – Technik und Poesie in Mitteleuropa – ist ein Feuilleton des Mironde Verlags (www.mironde.com) und des Freundeskreises Gert Hofmann.

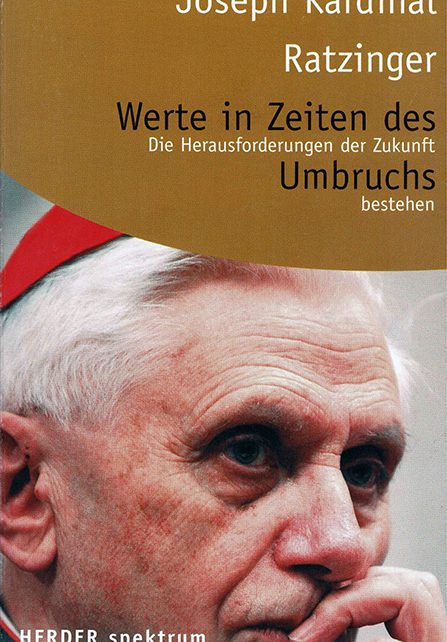
Es ist die Arroganz vieler westlicher Politiker und Denker, anderen Kulturen und Glaubensrichtungen, die sich von westlichen Denk- und Lebensweisen unterscheiden, ihren Willen aufzuzwingen und sie dem westlichen Massenkonsumdenken gefügig zu machen. Natürlich steckt dahinter auch der Profitmechanismus, der die bedenkenlose, unwiederbringliche Ausbeutung der Weltressourcen vorantreibt. Kriege im Nahen und Fernen Osten sowie in anderen Entwicklungsländern, geführt um Erdöl, zunehmend um Wasser aber auch um Boden und verschiedenste verkappte Rohstoffe etc., werden als legitime Mittel des „Kampfes gegen den Terrorismus“ deklariert, um ihren wahren Inhalt, des Kampfes um die Beherrschung der Ressourcenaneignung zu verschleiern. Andere Religionen, wie z.B. der Daoismus, der Buddhismus, sind viel näher der Natur und ihrer ursprünglichen Bewahrung zugewandt als die „christliche“ bzw. das was diese westlichen Politiker uns als Religion und den mit ihr begründeten kulturellen, verrechtlichten Führungsanspruch verkaufen wollen . Erinnert sei nur daran, dass mit der Christianisierung die heiligen Bäume der „Andersgläubigen“ gefällt und andere religiös verehrte Naturdenkmäler beseitigt wurden. Damit soll nicht gegen die ursprüngliche christliche Ethik gesprochen werden, die in vielem den ethischen Ansprüchen anderer Religionen gleicht bzw. ähnlich Werte vertritt. Die Realität der Politik des Westens ist weit von tradierten, religiös definierten Wertesystemen entfernt. Wenn Präsident Trump mit einer Bibel in der Hand auftritt, um von Bodygards bewacht, zur nahegelegenen Kirche zu gehen, ist es eine Persiflage auf christliche Werte an die farbige US-Bürger glauben oder will er an die Eroberung Amerkas mit dem Schwert und der Bibel erinnern? Die Vernichtung der indigenen, naturbezogenen Kulturen, die massenweise Vernichtung der Bisons und der Naturräume als Lebensgrundlage nordamerikanischer Indianer ohne weiteren Grund als das Vordringen in die Prärien des Westens durch Genozid zu erzwingen, zeigen Analogien zu dieser Denkweise wie auch andere Beispiele. Es geht heute nicht um die Verherrlichung westlicher Denkweisen und die Verhinderung des „Untergangs des Abendlandes“ und der „westlichen, fortschrittlichsten Zivilisation“ sondern um kulturelle Kooperation und Koexistenz im Sinne der Erhaltung des „einen Planeten“ und seiner kulturellen, historisch gewachsenen Vielfalt.