Die Johann-Gustav-Schnabel-Gesellschaft e.V. hielt wie jedes Jahr, Anfang November, ihre Jahreshauptversammlung in Stolberg, einem kleinen Harz-Städtchen mit hunderten historisch-wertvollen und originären Fachwerkhäusern, ab. Johann Gottfried Schnabel (1692 bis vor 1748), der Namensgeber der Gesellschaft, war am 7. November 1692 in einer protestantischen Pfarrersfamilie in Sandersdorf bei Bitterfeld geboren worden. Bereits mit zwei Jahren wurde er Waise. Verwandte nahmen ihn auf. 1702 kam er zur Schulausbildung in das Waisenhaus August Hermann Franckes nach Halle. Bereits 1706 hatte er die Schulausbildung verlassen und das Barbier-Handwerk erlernt, das damals auch medizinische Behandlungen umfasste. Schnabel nahm von 1709–1717 als „Feldscher“, als Truppenarzt, an mehrere Kriegen teil und kam schließlich 1724 nach Stolberg im Harz. Hier war er als Barbier und von 1731–1744 als alleiniger Autor und Redakteur der Zeitung „Stolbergische Sammlung neuer und merckwürdiger Weltgeschichte“ tätig. International berühmt wurde Schnabel mit einem Roman „Wunderliche Fata einiger Seefahrer, absonderlich Alberti Julii, eines geborenen Sachsen …“ dessen ersten Band er 1731 in Nordhausen unter dem Pseudonym „Gisander“ veröffentlichte.

Im Gesellschaftsraum des Werksverkaufs des traditionsreichen Dauerbackwaren-Herstellers „Friwi“ (Friedrich Witte) in der Langgasse 51, trafen sich die Mitglieder der Gesellschaft zu einer wissenschaftlichen Tagung bereits am Abend des 7. November. Der 8. November war bis zum Nachmittag den Vorträgen und Diskussionen gewidmet. Am Vormittag des 9. November fand die abschließende Jahreshauptversammlung statt. Am Nachmittag des 8. November referierte Dr. Thomas Grunewald zum Thema „Schnabel und die Stiftungen August Hermann Franckes“. Im Anschluss referierte Axel Wellner zum Thema „Johann Friedrich Penther (1693–1749) als Kammer- und Bergrat in Stolberg und als Professor an der Universität Göttingen“. Es schlossen sich jeweils umfangreiche Fragen an.
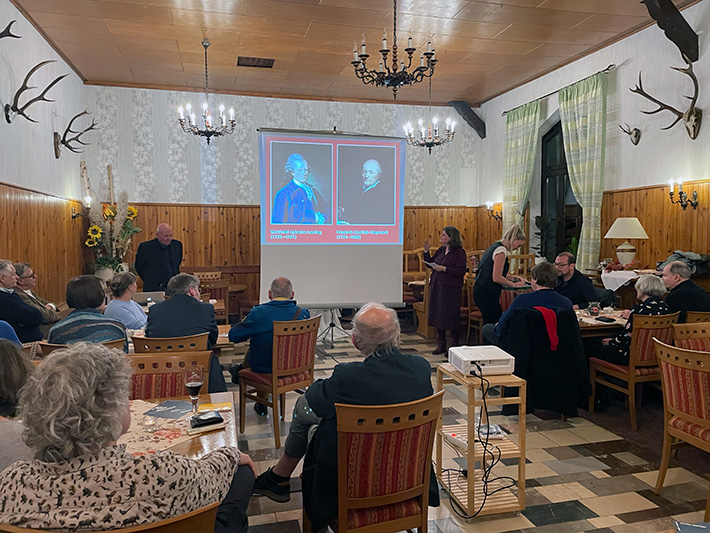
Am Abend trafen sich die Mitglieder der Gesellschaft im Restaurant des Stolberger Hotels Bürgergarten. Der Abendvortrag sollte zum Thema einer „Literarischen Wanderung durch Mitteldeutschland“ gehalten werden. Dr. Gabriele Leschke, die Vorsitzende der Gesellschaft, begrüßte den Mironde-Verlag und den Referenten Dr. Andreas Eichler. Der ging von Klopstocks Vermächtnis, wonach man den Weg von den Minnesängern bis Luther … auf seiner Wanderschaft gehen müsse aus. Lessing hatte diesen Gedanken 1777 als Motto seiner mitteldeutschen Sprach- und Literaturgeschichte aufgenommen, konnte das Vorhaben jedoch nicht mehr ausführen. Herder habe den Ansatz weitergeführt, welchen er versuche weiterzuführen.

In seinen Ausführungen mutete Eichler den Zuhörern einiges zu. Einerseits beschreibt er die Sprachlandschaft Mitteldeutschland, zwischen Braunschweig und Görlitz, als Ergebnis der Ostexpansion des ostfränkisch-deutschen Königreiches. Andererseits sucht er die Entstehung der Mittelhochdeutschen Sprache gerade in der Krise des imperialer Anspruches dieses Reiches zwischen 11. und 13. Jahrhundert nachzuweisen. Die Minnesänger waren es zunächst, die das Althochdeutsche in neue Formen brachten, die es erlaubten in deutscher Sprache nach einer Perspektive für das Individuum, zu suchen.

Typisch für Eichler war, dass er auf seinem Weg Meister Eckart die Referenz erwies. In Paris habe dieser die Vermittlung der modernen Wissenschaft in Lateinischer Sprache erlebt. Philosophie sei als „Liebe zur Weisheit“ und „Weisheit“ gemäß der Tradition als „Einheit der Gegensätze Glaube und Vernunft“ vermittelt worden. Aber „Glaube“ sei als Dogma und Vernunft als bloß folgerichtige Logik gelehrt worden. Dadurch habe sich diese Wissenschaft immer wieder selbst bewiesen. Die Alternative sei für Eckhart das Denken in deutscher Sprache, in der Form einer kleinen Predigt oder eines Lehrgesprächs geworden.

Leider verzichtete Eichler hier für seine Zuhörer auf die Erklärung eines wichtigen Zusammenhanges. Mit der in Paris gelehrten scholastischen Logik konnten keine neuen Erkenntnisse gewonnen, sondern lediglich bekanntes Wissen folgerichtig abgeleitet werden. Lewis Mumford macht in seinem epochalen Werk „Der Mythos der Maschine“ darauf aufmerksam, dass Galileo Galilei seine Methoden im Anschluss an die scholastische Logik entwickelte. Galilei machte die „bloße Quantifizierung“ zur Universalmethode der Naturwissenschaft: „Was nicht quantifiziert ist, existiert nicht!“ Die scholastische Logik und die neue Naturwissenschaft gingen hier eine Verbindung ein, die den Versuch der Beherrschung der Natur und der anderen Kulturen anstrebte. Immanuel Kant übernahm das Verfahren der bloß quantifizierenden Logik in die Philosophie. Er stieß dabei auf die Ambivalenz des Verfahrens. Man konnte mit den Mitteln dieser Wissenschaft „beweisen“, dass die Welt einen Anfang hat, man konnte aber auch „beweisen“, dass sie keinen Anfang hat. Statt an seiner Methode zu zweifeln, vermutete Kant, das mit der Wirklichkeit etwas nicht stimme. Ricarda Huch hob hervor, dass diese Wissenschaft ein Bild von der Natur hergestellt habe, als ob Natur etwas „neben“ dem menschlichen Leben sei. Verbunden mit dieser Art von Wissenschaft seien wachsende Verantwortungslosigkeit und Entpersönlichung. Heute dominiert die bloß quantifizierende Wissenschaft immer noch. Man liefert „wissenschaftliche“ Gutachten in jeder beliebigen Richtung. Auch die Computertechnik und die sogenannte „KI“ arbeiten auf bloß quantifizierender Grundlage. Mit dieser Methode können organische Systeme nicht adäquat erfasst werden. Symptomatisch ist, dass diese Art von Wissenschaft bisher keine Vorstellung vom Naturkreislauf erarbeiten konnte. Diesen Hinweis hätte man von Eichler schon erwarten können. Anyway.

Die Zuhörer atmeten sichtlich auf, als der Referent auf Johann Gottfried Schnabel zu sprechen kam. Eichler ersparte sich vor den versammelten Kennern die biographischen Vorbemerkungen. Er verwies auf dessen vielseitige Bildung und reiche Lebenserfahrungen. Die Tätigkeit als alleiniger Zeitungsredakteur war ein hartes Training seiner Vielseitigkeit. Eichler vermutete, dass Schnabel auch ein außergewöhnlich guter mündlicher Erzähler, auch in großem Kreis, in Gaststätten usw., gewesen sein könnte. Der Referent fügte an, dass Schnabel vor allem durch seine Erlebnisse als Militärarzt in Kriegen etwas zu erzählen hatte. All das sei in Schnabels Roman kulminiert, in dem Eichler die Aufnahme mündlicher Erzähltradition hervorhob. Einerseits in volkstümlicher Tradition und andererseits durch orientalische Einflüsse. Mit der Veröffentlichung wurde der Roman-Text Gegenstand der Überlieferung und auch der Veränderung. Ludwig Tiecks gab den Text unter dem fassbaren Titel „Die Insel Felsenburg“ neu heraus, kürzte und veränderte aber auch den Text. In seiner Vorrede wird deutlich, dass er die Neuausgabe gegen Vertreter der „abstrakten Aufklärung“ verteidigen musste.

Im Anschluss bat Eichler die Mitglieder der Schnabel -Gesellschaft um Hilfe. Im Band 2 der Literarischen Wanderung gibt es ein Kapitel über Robert Schumann. Dessen Mutter Christiane (1767–1826) war eine Tochter des Zeitzer Stadt- und Ratsarztes Abraham Gottlob Schnabel (1737–1809). Gibt es hier verwandtschaftliche Zusammenhänge? Eichler ergänzte, dass die Frau des Ratsarztes, Johanna Sophia (1745–1818), die Großmutter Schumanns mütterlicherseits, eine Nichte Gotthold Ephraim Lessings war.

Eichler schaffte die Literarische Wanderung tatsächlich in 45 Minuten zu gehen. Es schloss sich eine angenehme Diskussionsrunde an, die fast nocheinmal so lange dauerte. Den Mitgliedern und dem Vorstand der Johann-Gottfried-Schnabel-Gesellschaft ist für ihr außerordentliches Engagement zu danken. Die Stadt Stolberg kann sich über solche Gäste glücklich schätzen. Zugleich verfügt die Stadt mit den Tagungsorten „Friwi“ und „Hotel Bürgergarten“ auch über exzellente Voraussetzungen für solche Veranstaltungen.

Im Anschluss an die Tagung besuchten wir das in Stolberg im Vorjahr aufgestellte Schnabel-Denkmal von Thomas Jastram. Gleichzeitig wurde in Schnabels Geburtsort Sandersdorf 2024 auch ein Schnabel-Denkmal von Jastram positioniert. Die Finanzierung übernahm ein zu diesem Zweck aus der Mitgliedschaft der Schnabel-Gesellschaft gegründeter Förderverein. Eine unglaubliche Leistung steckt hinter diese beiden Denkmälern.
Johannes Eichenthal
Die Litterata – Technik und Poesie in Mitteleuropa – ist ein Feuilleton des Mironde Verlags (www.mironde.com) und des Freundeskreises Gert Hofmann.
Information
Johann Gottfried-Schnabel:Gesellschaft: https://schnabel-gesellschaft.de/johann-gottfried-schnabel/
Tourist-Information Stolberg: https://gemeinde-suedharz.de/tourismus/tourist-information/
Die Bücher zum Vortrag können direkt beim Verlag bestellt werden
Andreas Eichler: Literarische Wanderung durch Mitteldeutschland. Sprache und Eigensinn 3. Von Thomas Mann bis Gundermann: https://buchversand.mironde.com/p/andreas-eichler-literarische-wanderung-durch-mitteldeutschland-t-3-von-thomas-mann-bis-gundermann
Andreas Eichler: Literarische Wanderung durch Mitteldeutschland: Teil 1 bis 3: https://buchversand.mironde.com/p/eichler-literarische-wanderung-durch-mitteldeutschland-teil-1-3

