Zum Jahreswechsel wollen wir das Interesse der Leser auf einige Zeitschriften richten helfen. Auf den ersten Blick wirkt das Spektrum, in unserer Zeit der Spezialisten, vielleicht zu breit. Es reicht von moderner Bautechnologie über Technikgeschichte, Bücher- und Literaturgeschichte bis hin zur modernen Buchbranche. Der »rote Faden« dieses Querschnittes ist unsere Position, dass sich der Mironde-Verlag den Herausforderungen moderner Technologien stellen will, dass diese Technologien aber eine breite Akzeptanz bei anderen Disziplinen und in der Öffentlichkeit benötigen und dass Technologien erst kommunizierbar werden, wenn sie in eine literarische Form gebracht werden.
Hier unsere Auswahl
Seit 22 Jahren gibt das Ingenieur-Planungsbüro iC Consulenten Ziviltechniker GesmbH in Wien zum Jahresabschluss eine Zeitschrift heraus. Autoren aus verschiedenen Bereichen des Unternehmens versuchen in zusammenfassenden Artikeln ein Fazit des abgelaufenen Jahres zu ziehen, um für das neue Jahr den Ausgangspunkt zu formulieren. Chronik-Dokumentation, Analyse und Perspektivbestimmung fallen hier zusammen.
In der Edition 22/2018 finden wir zehn Artikel. Neun davon werden in deutscher und englischer Sprache abgedruckt. Wir können uns nur auf einige davon konzentrieren.

Ivan Krofak, Klaus Kogler, Andreas Helbl sind die Autoren eines Artikels über nachhaltige Stadtentwicklung als Basis für die »Smart Cities der Zukunft« (S.51ff). Die Autoren verweisen auf die prognostizierte Erhöhung des Anteils der Stadtbewohner für 2050 auf 70 %. Im Bau- und Immobilienbereich seien Nachhaltigkeitskriterien entwickelt worden, die es nun gelte auf der Ebene ganzer Stadtviertel und Städte umzusetzen. Entsprechende Kriterien müssten auch für Infrastrukturentwicklungen und soziales Wohlergehen definiert werden. Die Autoren betonen, dass es keiner »Big Data« bedürfe, um diese Ziele zu erreichen. Es stünden zudem leistungsfähige Planungs- und Simulationswerkzeuge zur Verfügung. Die Autoren verweisen darauf, dass die Arbeit in historischen Stadtvierteln besonders anspruchsvoll ist und dass in den dicht verbauten städtischen Gebieten Heiz- und Kühlsysteme die nahliegende Einstiegsthemen sind. Zumal im EU-Gugle-Projekt eine Senkung des Energieverbrauches um 40–80 % und eine Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energiequellen um 25 % angestrebt wird. Anwendungsbeispiele bereichern den Artikel.
Stefan Sattler, Elisabeth Mattersberger und Martin Pfemeter sind die Autoren eines Artikels mit dem Titel »3D-Numerische Strömungsberechnungen« (S: 17ff). Der derzeitige Stand der Technik im Wasserbau sei die 2D-Numerische Simulation. Dreidimensionale Strömungen könnten damit aber nicht dargestellt werden. Bei komplizierten Fragestellungen sei der Einsatz von 3D-Modellen zur Optimierung der Planung, die auf 2D-Basis erstellt wurde, zu erreichen. Durch den hohen Aufwand bedingt sei der Einsatz von flächendeckenden 3D-Modellen, die im Wasserbau oft mehrere Kilometer umfassten, nicht zielführend. Doch zur Beantwortung von Detailfragen sei die Methode gut nutzbar. An einem Staudamm-Beispiel verdeutlichen die Autoren, dass mit dem 2D-Modell ein paralleler und ein vertikaler Schnitt der Wasseroberfläche darstellbar sei. Eine vorhandene Kehrströmung, in detaillierten Fließgeschwindigkeiten, sei nur mit der 3D-Methode nachweisbar. Besonders interessant ist hier, dass das 3D-Modell im Unterschied zu tiefengemittelten Modellen nicht Mittelwerte, sondern den gesamten Querschnitt an Fließgeschwindigkeiten darstellen kann.
Nathan Torggler überschreibt seinen Beitrag mit »Digitalisierung im Team 12. Aus dem Salzburger BIM-Stübchen« (S. 41 ff). Der Autor hebt hervor, dass die BIM-Methode aus dem Hochbau heraus entwickelt wurde. Hier seien die Bezugsebenen Etagen. Die Modellierung von Infrastrukturprojekten (Brücken, Straßen, Tunnel) erfolge jedoch ohne Bezug zu Etagen entlang einer Trassierung. Bisher gebe es keine geschlossene Softwarelösung für die 3D-achsenbezogene Modellierung von räumlichen Strukturelementen. Als Vorreiter in der iC-Gruppe habe man in Salzburg für das Projekt »Karawanketunnel Süd« spezielle Softwaremodule entwickelt, welche eine räumlich korrekte Darstellung von Tunnelblöcken und Innenausbauteilen ermöglicht. Dazu wurden eine Reihe von tunneltypischen Bauteilen entwickelt. Der Einsatz dieser Module wird vom Autor am Beispiel des Projektes »Karawanketunnels Nord« dargestellt. Er spannt den Bogen vom BIM-Konzeptmodell, über das BIM-Entwurfsmodell/Mengenmodell, das BIM-Produktionsmodell, das BIM-Bestandsmodell zum BIM-Geologiemodell. Allein das BIM-Entwurfsmodell besteht aus 22.000 Bauteilen.
Johannes Weil und Kilian Scharrer überschreiben ihren Beitrag mit »Hammer, Drohne und Laptop. Digitalisierung in Geologie und Geotechnik« (S. 33 ff). Die Autoren betonen, dass man in der iC seit einiger Zeit bei der Arbeit im Baufeld die Methode der Fotogrammetrie einsetzt. Die räumliche Lage und die dreidimensionale Form eines Objektes wird dabei durch digitale Fotos von unterschiedlichen Standorten bestimmt. Es können dafür sowohl händische Fotos als auch Drohnenfotos eingesetzt werden. »Diese Daten sind georeferenziert und ermöglichen es, Informationen, wie Strecken, Flächen, Richtungen, Höhen und Volumina hochgenau zu entnehmen.« Fotos und Notizen lassen sich verorten und können in Geo-Informations-Systemen (GIS) und 3D-Modellen eingesetzt werden.
Bei der geologischen Dokumentation im Tunnelvortrieb sind Fotogrammetrie, Laserscan, Multispektralanalyse und digitale Dokumentation z.B. in GIS-Systemen Stand der Technik.
Die Zusammenführung der Daten ermögliche vereinfachte Plausibilitätsprüfungen, die leichtere Identifizierung von Informationslücken, eine einfachere Korrelation und Interpretation. Die darauf aufbauende dreidimensionale Modellierung von geologischen Schichten, Gebirgsarten, tektonischen Strukturen und hydrogeologischen oder geotechnischen Parametern wurde bereits in Bergbauprojekten, Tunnelbau, Autobahnbau, Wasserkraftwerken, Staudämmen, Staumauern und Analysen zur Sicherung vor Naturgefahren angewandt.
Ein geologisches/geotechnisches Modell kann heute über den gesamten Projektzeitraum an neue Erkenntnisse angepasst werden. Im Zuge der BIM-Planungen können diese Modelle in ein Gesamtmodell (»Common data enviroment«) integriert werden.
Der erfahrene Experte für Bauprojektmanagement, iC-Partner seit der Firmengründung und Horarprofessor an der TU Wien, Wilhelm Reismann, und der junge BIM-Experte Christoph Eichler überschreiben ihren Beitrag mit »Das digitale Bauprojekt. Planen, Bauen, Betreiben.« (S. 25 ff)
Die Autoren heben hervor, dass sie mit dem Beitrag den Sinn des Ganzen erfassen helfen wollen. Deshalb beziehen sie alle derzeit üblichen und in Entwicklung befindlichen Inseln der Digitalisierung des Bauwesens ein, um Zusammenhänge zu verdeutlichen.
Die Autoren wollen und auch Leserinnen und Leser erreichen, die bisher noch kaum mit der Digitalisierung von Planen, Bauen und Betreiben zu tun hatten. Deshalb unterscheiden sie zunächst Grundprozesse:
- Entwickeln und Organisieren
- Planen und Bauen
- Nutzen und Betreiben.
Entwickeln und Organisieren nähmen üblicherweise sehr viel Zeit in Anspruch. In dieser Zeit erfolgten wesentliche Weichenstellungen, die für das Gelingen des Projektes wesentlich seien.
Obwohl Neubau-Projekte und Bestandsbau-Projekte unterschiedlich beginnen, stimmten danach die weiteren Phasen überein.
Die Autoren nennen als nächsten Punkt »Digitale Grundprozesse«.
Hier erwähnen sie, dass zunehmend digitale Einreichung von Bauanträgen möglich sind, wie zum Bauspiel in Wien. Wenig erforscht sei der Bereich Ausschreibung, Vergabe, Vertrag, Abrechnung.
In der Planung werde das BIM-Planungsmodell in das BIM-Vertragsmodell und das BIM-Baustellenmodell weitergeführt.
Es geht weiter mit dem Punkt: »Der digitale Prozess im Detail«.
Als Grundregel nennen die Autoren hier, dass alle Prozess bereits vor der Digitalisierung zu analysieren und zu optimieren seien, um nicht die »falschen« Prozessabläufe zu digitalisieren.
Die Entwicklung von offenen Merkmalservern als zentrales Instrument für Auftraggeber und der Aufbau digitaler Produkt-Bibliotheken (BIM-Libraries) seien international im Gange.
Ein Vorzug der Digitalisierung sei die Vereinfachung von Zustands- und Bewertungsberichten.
Die digitale Zustandsanalyse von bestehenden Bauwerken sei mit diesen Voraussetzungen kostengünstig möglich.
Der abschließende Schwerpunkt ist überschrieben mit »Benchmarks und Regelkreise über den Lebenszyklus«.
Die beiden Autoren formulieren: »Selbstlernende Regelkreise, gespeist durch menschliche Erkenntnisse und Erfahrungen sowie digitalen Input aus der Sensorik und dem Internet of Things werden zu immer besseren Grundlagen für Entscheidungen und Planungen.«
Die Autoren schränken im Punkt »Künstliche Intelligenz« aber ein: die Dinge werden ja nie wirklich intelligent werden. Unsere Intelligenz verschafft Ihnen im Zuge der Digitalisierung und Automatisierung Funktionen, die uns unterstützen.
Die Autoren folgern, dass gerade durch die Abgabe von Hilfsfunktionen an die Technik die Kreativität und wahre Intelligenz, also die emotionale menschliche Intelligenz noch mehr an Bedeutung gewinnen würden.
Die beiden Autoren beziehen hier gegen den Wissenschafts-Mainstream, der IT als Religionsersatz betreibt, eine verantwortungsbewusste humanistische Position. Das ist eine solide Grundlage für den kritischen Umgang mit neuen Technologien.
Als weiterführende Links nennen die beiden Autoren
http://www.buildingsmart.at
Dieser Artikel demonstriert dem Anschein nach in konzentrierter Weise das Anliegen der ganzen Publikation. Aber es bleibt die Frage: was ist »wahre, emotionale, menschliche Intelligenz«?
Menschliche Vernunft ist keine Eigenschaft des Menschen neben anderen, sondern gehört zur Disposition des Menschen. Vernunft ist mit Sprache eng verbunden. Diese Vernunft/Sprache entsteht als innerer Zusammenhang aller Sinneswahrnehmungen als inneres Bild. Johann Gottfried Herder nannte diese Fähigkeit der Zusammenfassung aller Sinnesinformationen Besonnenheit. Es ist die Basis aller menschlichen Bildung und die Grundlage für qualitative Urteile. In der Sprache werden alle unsere Sinneswahrnehmungen zusammengefasst, kommunizierbar und zugleich Voraussetzung unserer Handlungssteuerung.
Johann Gottfried Herder geht davon aus, dass wir uns als ein Ganzes fühlen und deshalb überall das »Ganze« suchen. Er unterscheidet Historische Ganze, Philosophische Ganze und Mathematische Ganze: »Mathematische Ganze sind unfehlbarer denn die übrigen. 1) Weil sie Ganze, ohne auf Qualität und Zeitmaß Rücksicht zu nehmen, blos von Seiten der Quantität betrachtet, indem sie sich blos mit Flächen und Zahlen beschäftigt. 2) Weil sie durch keine Sprache sich verwirrt, eigentlich blos dem Verstande Größen zeigt und 3) blos den Regeln der engsten Ordnung, der genauesten Aufeinanderfolge beobachtet.« (Aus Gotthilf Heinrich Schuberts Mitschrift von Herders Abendvorträge im Frühjahr 1799. In: Gotthilf Heinrich Schubert – ein anderer Humboldt. Mironde Verlag 2010, S. 64)
Mathematische Logik ist keine »reine Vernunft«, sondern nur ein Hilfswerkzeug, dass auch in Digitalisierung und Automatisierung nur quantitative Relationen, keine qualitativen Verhältnisse erfassen kann.
Die Bildung zur Humanität ist die Voraussetzung der menschliche Fähigkeit zum qualitativen Urteil. Ohne humanistische Bildung sind uns keine qualitativen Urteile möglich. Die Humanität steht aber auf zwei Säulen: auf der Vernunft, die im Kern Skepsis ist, die uns aus unseren Fehlern lernen lässt, und auf dem existenziellen Glauben, der im Kern Hoffnung ist, der uns die Ahnung davon gibt, dass unser Leben einen Sinn hat. Die Gegensätze von Vernunft und Glauben ermöglichen uns unseren Platz im Kosmos zu finden und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Der Mensch muss also die »Künstliche Intelligenz« steuern und kontrollieren können und wollen. Wenn menschliche Entscheidungen an die KI abgegeben werden, dann wird, wie der Architekt Lewis Mumford in seinem Buch »Der Mythos der Maschine« betont, die Wahrscheinlichkeit der Beibehaltung des einmal eingeschlagenen Kurses erhöht und die Wahrscheinlichkeit von Alternativen vermindert. KI ist nur zu »Detail-Kurskorrekturen« fähig (vgl. die Arbeit eines Navigationssystems). Es handelt sich in der Wirklichkeit um die strukturelle Unfähigkeit zur Umkehr.
Den beiden Autoren Wilhelm Reismann und Christoph Eichler gebührt Dank, sie verbinden ihren resümierenden und verständlichen Fachartikel mit der menschlichen Verantwortung für unsere Welt. Das ist leider noch ein singuläres Herangehen in der Technologieentwicklung.
Information
http://www.ic-group.org
communiCation. Die Zeitschrift der iC. Edition 22/2018

Die Pirckheimer-Gesellschaft e.V. gibt die Zeitschrift »Marginalien. Zeitschrift für Buchkunst und Bibliophilie« heraus. Eben erschien Heft 4/218 (Heft 231).
Im Vorab-Wort benennt Till Schröder Anzeichen für den wachsenden Bedeutungsverlust von Büchern, zieht sich aber auf die in der Branche übliche Selbsttröstung zurück: »Alte Medien werden von den neuen nie vollständig verdrängt … Die Marginalien suchen daher lieber in den Nischen von Gegenwart und Vergangenheit nach Best Practic, wie es die Managementkurse so gerne predigen.« (S. 3)
Es folgen 13 Artikel, ein Debattenbeitrag, drei Rezensionen und Nachrichten aus der Pirckheimer Gesellschaft.
Besonders beeindruckte uns der Beitrag des promovierten Historikers Christoph Links über das Schicksal von Kinderbuchverlagen in der DDR (S. 27ff). In vorbildlich nüchterner Weise schildert Links die oft dramatischen Geschichten ausgewählter Verlage. Der Jurist und Buchhändler Paul Zahl erhielt am 12. Dezember 1946 die Lizenz der Besatzungsmacht zur Gründung des Peter-Paul-Verlages in der Feldberger Bahnhofstraße 1a. Die Bücher des Verlages waren in der geistigen Nachkriegssituation begehrt. Dem Amt für Literatur und Verlagswesen, schwebte dem Anschein nach aber eine Verstaatlichung der Verlage vor. Man verweigerte dem Peter-Paul-Verlag 1951 die Neulizenzierung. Paul Zahl fühlte sich bedroht und verließ mit seiner Familie 1953 die DDR. Doch er konnte in der Bundesrepublik nie wieder Fuß fassen. In der DDR ging der zurückgelassene Verlag 1955 in die Liquidation.
Der Verlagsbuchhändler und das KPD-Mitglied Alfred Holz erhielt am 28. August 1946, dem Geburtstag Goethes, innerhalb einer Verlagsgemeinschaft eine Lizenz der SMAD. Die Geschäftstätigkeit des Verlages wurde immer wieder durch fehlende Papierzuteilungen behindert. So konnten keine effizienten Auflagengrößen erreicht werden. Daraus ergaben sich finanzielle Engpässe, die durch zusätzliche Kreditaufnahmen und Rechnungsstundungen der Druckerei abgfangen werden mussten. Die Hauptverwaltung Verlagswesen bot Alfred Holz eine staatliche Beteiligung an, doch dieser wollte seinen Verlag vollständig in Staatseigentum überführen. Nach einer schweren Erkrankung stimmte Holz 1961 der Überführung seines Verlages als Imprint in den SED-eigenen Kinderbuchverlag zu.
Der Verlag Ernst Wunderlich wurde 1876 in Leipzig gegründet. Der Enkel des Verlagsgründers Hans Wunderlich, erhielt 1947 eine Verlagslizenz in Leipzig. 1948 ging Hans Wunderlich aber nach Worms und gründerte dort eine Verlagsbuchhandlung. 1955 erfolgte die Trennung der beiden Firmenteile. 1957 wurde der Leipziger Wunderlich-Verlag in Prisma-Verlag umbenannt. Der Kinder- und Jugendbuchbereich wurde aufgegeben. Kulturgeschichte prägte das Verlagsprofil. 1984 verkauften die Inhaber den Verlag an den LDPD-Buchverlag »Der Morgen«. Dort wurde der Prisma-Verlag bis 1991 als Imprint weitergeführt.
1933 gründeten Karlfriedrich Knabe und seine Ehefrau Helene Knabe die Weimarer Druck- und Verlagsanstalt mit Druckerei, Buchbinderei, Buchhandlung und Antiquariat. Im Jahre 1947 erhielten der Verlag eine Lizenz der Besatzungsmacht. 1948 wandelten Karlfriedrich Knabe und sein Sohn Gerhard das Unternehmen in eine OHG um und änderte den Namen in »Gebr. Knabe Verlag«. Von da an wurden vor allem Kinderbücher verlegt. Bei der Neulizenzierung wurde die Lizenz ausschließlich auf Gerhard Knabe vergeben, jedoch einer Erweiterung des Verlagsspektrums (Jugendliteratur, Romane, Erzählungen, historische Biographien) zugestimmt. 1972 wurde die Druckerei verstaatlicht. 1983 lief die Verlags-Lizenz aus. Der Verlag wurde 1984 abgewickelt. Mit dem 1. Januar 1985 ging das Verlagsvermögen an den Postreiter-Verlag in Halle über. In der Folge der Wiedervereinigung ging 2002 der Postreiter-Verlag in den Besitz des Beltz-Verlage in Weinheim über. Im Jahre 2006 gründete der Urenkel des Verlagsgründers Steffen Knabe den Verlag unter dem Namen »Gebr. Knabe« in Weimar neu.
1903 gründete Rudolf Arnold seinen Verlag in Leipzig. 1948 erhielt sein Erbe Viktor Emanuel Johannes Arnold eine Lizenz der SMAD als Jugendbuchverlag. Mit der Neulizenzierzung 1951 musste sich der Verlag auf Kindernbücher spezialisieren. Zunächst erschienen vier bis fünf Titel im Jahr, Anfang der 1960er Jahre10–15 und in den 1970er Jahren 20–25 Titel. Nach dem altersbedingten Ausscheiden des Lizenzinhabers wurde der Verlag ab 1. Januar 1989 als eine Art Imprint dem SED-eigenen Urania Verlag Leipzig angegliedert. Beim Verkauf der Urania-Gruppe durch die Treuhand-Anstalt hatte die Dornier-Gruppe kein Interess am Arnold Verlag. Dieser stellte Ende 1990 seine Produktion ein. 1994 wurde er aus dem Handelsregister gelöscht. Das Archiv des Arnold Verlages gelangte mit dem Urania-Bestand zur Dornier-Gruppe.
Vielleicht erscheint dem einen oder anderen Leser diese Beschreibung der Verlagsschicksale zu aufwändig? Aber Christoph Links macht sich die Mühe, um auf die Besonderheit jedes einzelnen Verlagsschicksales aufmerksam zu machen. Jeder Verlag hatte eine etwas andere Geschichte. Gerade um die Besonderheiten geht es in der historischen Forschung, nicht um Durchschnittsvergleiche.
Ein Porträt der Buchillustratorin Gertrud Zucker aus der Feder von Elke Lang (S. 38ff) liest sich sehr interessant. Die junge Frau nahm 1954 ein Studium an der Kunsthochschule in Berlin-Weißensee auf. Besonders beeindruckt war sie von Professor Werner Klemke, der ihr eine völlig neue Sehweise vermittelte: »Wir sollten nicht nur die bildliche Darstellung im Auge haben, sondern mit der Grafik die Typografie und die Seitengestaltung mitdenken.« Ausführlich wird in Abbildungen und Erläuterungen das Lebenswerk von Getrud Zucker vorgestellt.
Klaus Walther, ein promovierter Germanist, Autor, Journalist, Lektor, Herausgeber, Verleger und Buchhändler, plaudert im hinteren Teil des Heftes (S. 103ff) über seine 62jährige Suche nach einem Holzschnitt des Straßburger Münsters. Eigentlich gab es vier Auflagen zu je 1000 Exemplaren, die im Leipziger Insel-Verlag erschienen. Doch der Schnitt war sehr begehrt und selten zu erstehen. 1933 hatte Rudolf Koch die Zeichnung gefertigt, Fritz Kredel und Lisa Hampe schnitten diese in Holz. Die vierte Auflage des Holzschnittes erschien 1954 in Leipzig.
Der Student Klaus Walther sah ein letztes Exemplar im Leipziger Antiquariat Engewald, schreckte aber zunächst vor dem Preis zurück. Als er sich besonnen hatte, war es bereits zu spät. Der Schriftsteller und Lektor Eberhard Panitz hatte es erworben und wollte es nicht abgeben. (Dem Anschein nach war der Schnitt für Panitz so wichtig, dass er ihn sogar in der, nach seinem Buch verfilmten Geschichte »Die sieben Affären der Dona Juanita« in einer Rolle »mitspielten« ließ.)
Wir wissen, dass es Klaus Walther versteht Geschichten zu erzählen. Diese Geschichte hat etwas Sinnbildliches: der Autor nimmt uns mit auf sein lebenslanges Suchen.
Information
Marginalien. Zeitschrift für Buchkunst und Bibliophilie.
ISSN 0025-2948 Erscheint viermal jährlich
www.pirckheimer-gesellschaft.org

Die von Dipl.-Ing. Wolfgang M. Buchta herausgegebene, Zeitschrift »Austro Clasic. Das östereichische Magazin für Technik-Geschichte« zählt, wie die Marginalien«, auch Liebhaber zu ihren Lesern. Mit 7 Seiten Buchrezensionen, von insgesamt 162 Seiten, macht die Zeitschrift aber deutlich, dass Auto-Liebhaber auch Buch-Liebhaber sein können.
Das Heft 6/2018 verspricht auf der Titelseite, unter der Überschrift »The New Ford«, die Geschichte des Ford-Modells A. Auf den Seiten 28–43 stellt der Herausgeber selbst die Titelgeschichte vor. Er beginnt mit der Person des 1863 als Sohn eines Farmerehepars geborenen Firmengründers Henry Ford. Nach dem Besuch einer Dorfschule nahm er eine Maschinistenlehre auf. Bereits mit 15 Jahren konstruierte er seinen ersten Verbrennungsmotor. Nach mehreren berufsstationen wurde er im Unternehmen von Elektropionier Edison schließlich Chefingenieur.
1899 machte sich Henry Ford zum ersten Mal selbstständig. Es wurden aber zunächst nur Pleiten und er musste sich mehrfach von den falschen Geschäftspartnern trennen. 1903 gründete er mit 11 Investoren, die er erst 1919 auzahlen konnte, die Ford Motor Company (FoMoCo). In den Folgenden Jahren produzierte das Unternehmen Autos mit den Bezeichnungen Ford A, Ford B bis im Jahre 1908 hin zu Ford T. Das wurde das erfolgreichste Modell der Unternehmensgeschichte. Zwischen 1908 und 1927 baute und verkaufte die Firma 15 Mio. Ford T.
Fords 1894 geborenen Sohn Edsel Bryan, seit 1919 Präsident der Firma, war es, der dem Vater schließlich nahelegte, dass der Ford T nicht mehr den technischen Anforderungen genüge. Es eskalierte ein klassischer Vater-Sohn-Konflikt. Doch die beiden hatten die Souveränität sich zu einigen. Der Vater war danach für die mechanischen Komponenten und die Qualitätssicherung zuständig und der Sohn für das Design. Dazu verbündete sich Edsel Ford mit dem ungarischen Designer Jozsef Galamb. Als Vater-Sohn-Projekt entstand das Konzept des »New Ford« mit der Bezeichnung Ford A – als Symbol für einen Neuanfang des Unternehmens.
Buchta berichtet vorbildlich nüchtern von den dramatischen Umständen. Eine erste Konstruktionszeichnungen vom Sommer 1926, die mündliche Anweisung zum Konstruktionsbeginn durch Henry Ford, die Werkszeichnungen im Januar 1927 fertiggestellt, im März 1927 ein erstes Fahrgestell getestet.
Am 27. Mai 1927 lief der letzte Ford T vom Band. Das Werk wurde geschlossen und die 260.000 Arbeiter entlassen. Die 10.000 Ford-Händler lebten danach zum Teil nur vom Ersatzteilverkauf, viele mussten ihr Geschäft aufgeben.
Über die Entwicklung des neuen Modells A gab Henry Ford zunächst nichts bekannt. Nichteinmal die Ford-Händler wussten, wie es weitergehen sollte.
Das früher für die Traktoren-Fertigung genutzte Werk River Rouge wurde zur Herstellung des Ford A umgerüstet. In Fünf Monaten investierte das Unternehmen 250 Mio. Dollar. (Der geplante Verkauspreis des Modell A betrug 385,00 Dollar). Es wurden 150.000 qm zusätzliche Produktionsfläche geschaffen, 40.000 Werkzeugmaschinen verlagert bzw. neu angeschaff, darunter 6 Karosserie-Presen zu je 250 Tonnen, 100 Kilometer Fließband u.a.. Etwa 200.000 Arbeiter wurden mit reduziertem Lohn wieder eingestellt.
Nach Testversionen wurde am 1. November 1927 mit der Serienproduktion begonnen. Zunächst 20 Stück pro Tag, im Januar 1928 waren es 195 Stück, Ende 1928 waren es 6435 pro Tag.
Mit gigantischer Werbung (2000 ganzseitige Annoncen in Tagszeitungen für 1 Mio. Dollar) wurde die Marktführerschaft errungen. Dennoch schrieb Ford am Jahresende 70 Mio. Dollar Verlust. Ende 1929 waren 1,9 Mio Fahrzeuge verkauft und die Markführerschaft gegen Chevrolet zurückgewonnen. Am 4. Februar 1929 war der Motor mit der Nummer 1.000.0000 gebaut worden. Trotz des Börsenkrachs von November 1929 schloss Ford das Jahr mit 90 Mio. Dollar Gewinn ab. Doch im Jahre 1930 wirkte sich die Finanzkrise auf Händler und Käufer aus. Die Produktion musste gedrossel werden, die Belegschaft auf 108.000 reduziert. 1931 setzte sich der Abwärtstrend fort. Im März 1932 stellte das Unternehmen die Produktion des Ford A ein.
Beim Marsch von 3000 Arbeitslosen von Detroit nach River Rouge im März 1931,schritt die Polizei ein. Es waren vier Tote und 20 Verletzte Demonstranten zu beklagen.
Das ist etwa die Fabel der Geschichte. Wolfgang Buchta liefert jedoch noch viel mehr Informationen. Zudem ist der Artikel umfassend und informativ illustriert. Der Autor hat den Punkt gefunden, von dem aus ein äußerst interessanter Zugang zur Unternehmensgeschichte möglich ist. Er vermag es, die Spezifik der Erfinderpersönlichkeit mit der des Familienunternehmens zu verbinden. Die Konzentration der Produktionsgeschichte auf ein Modell macht uns Zusammenhänge fassbar. Das Zusammenfallen der Produktgeschichte mit der Weltwirtschaftskrise 1929 bis 1932, lässt uns die Probleme der Zeit von »innen« her, aus der Sicht wichtiger Akteure, verstehen. Die Schilderung der finanziellen und sozialen Kosten und der Aufwendungen der Großserienproduktion ermöglichen einen seltenen Einblick, den manche 1500-Seiten-Publikation nicht vermag.
Wir möchten anfügen, dass in diese Zeit auch die Fixierung des Punktes in der Großserienproduktion durch Henry Ford fällt, in dem sich die Stückkosten wieder erhöhen. Durch eigene Erfahrung vermochte Ford zu lernen, dass Großserien nicht unendlich effektiv sind. Diese Lernfähigkeit ist eine Besonderheit Henry Fords und seines Sohnes, der Unterschied zu durchschnittlichen Unternehmern und Managern.
Im Heft finden wir eine große Zahl an Hinweisen und Information von Oldtimer-Veranstaltungen. Ebenso finden sich viele Reportagen von solchen Ereignissen. Außer dem Artikel über das Ford Modell A finden wir noch einige weitere Sachartikel. Auf Seite 105 folgen schließlich 7 Seiten Buchrezensionen. Mit ausführlichen Nachrichten österreichischer Oldtimerclubs schließt das informative und anschauliche Heft ab.
Information
Austro Classic – Das österreichische Magazin für Technikgeschichte Verlags GesmbH.
Die Zeitschrift erschein sechsmal jährlich.
www.austroclassic.com
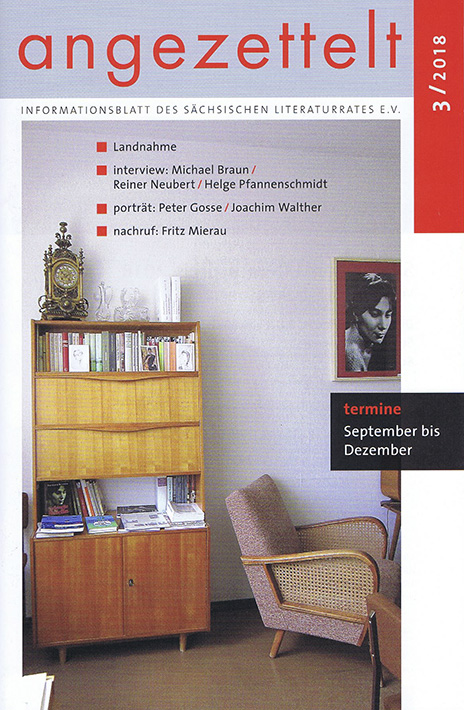
Der Sächsische Literaturrat e.V. in Leipzig gibt ein Informationsblatt mit dem Titel »angezettelt« heraus. Eben erschien Heft 3/2018. Ein Interview mit dem Lyriker Peter Gosse und ein Nachruf auf den Slawisten Fritz Mireau ragen aus dem Inhalt heraus. Prof. Reiner Neubert erhält Gelegenheit über das deutsch-tschechische Literaturverhältnis zu sprechen. Er engaiert sich seit vielen Jahren für den kulturellen Austausch mit dem Nachbarland.
Mit ausgewählten Buchvorstellungen und Veranstaltungsterminen schließt das Buch ab.
Begonnen hatte das Heft mit einer Stellungnahme des Literaturrates zum »Zwischenbericht zum Zweiten Kulturwirtschaftsbericht« der Sächsischen Staatsregierung.
Die Stellungnahme endet mit: »Unter dem Teilbereich ‹Buchmarkt› werden gefasst: Selbstständige Schriftsteller, Selbstständige Übersetzer, Buchverlage, Einzelhandel mit Büchern, Antiquariate, Buchbindereien/Druckweiterverarbeitung. Diese Zusammenstellung mag auf das ‹Warenprodukt Buch› berechtigt sein, sie berücksichtigt aber nicht, dass Schriftsteller, Übersetzer und Buchverlage in erster Linie kulturelle Leistungen erbringen, die vergleichbar Theatern eben nicht nach Prinzipien des Marktes und der Wirtschaft betrachtet werden können und sollten. Hier geht es (…) besonders im Bereich Literatur um ganz andere (nur auf den ersten Blick ‹unwirtschaftliche›) Aspekte.«
Die Thematik ist ohne Zweifel interessant. Dazu könnten wir uns eine Diskussion vorstellen.
Vielleicht könnten wir drei verschiedene Aspekte unterscheiden?
- Die in der Stellungnahme aufgezählten Akteure eint ihre selbständige Existenz. Das Schicksal wollte es, dass sich gerade im entindustrialisierten Ostdeutschland kleine Familienunternehmen neu gründeten. Im Kulturbereich arbeiten bereits weit mehr als 50 Prozent aller Beschäftigten als Selbständige. Der Kulturbereich ist in diesem Punkt ein Vorreiter. Mittelfristig wird die Mehrheit der Bevölkerung wieder in kleinen Familienbetrieben arbeiten.
- Was ist der Markt? Er ist kein Subjekt. Was wir »Markt« nennen, ist die Sphäre des Austausches zwischen verschiedenen Eigentumsformen.
- Wenn von »Wirtschaft« gesprochen wird, dann in der Regel von Großindustrie und Finanzsektor. Seit Ende des 19. Jahrhunderts wurde in Deutschland »Unternehmensgröße« subventioniert, um Welteinfluss zu erlangen. Mit der Subventionierung von Größe werden gleichzeitig Familienbetriebe benachteiligt. Die Gleichberechtigung aller Eigentumsformen ist aber eine Voraussetzung für die heute neu zu findende Verbindung der Gegensätze wirtschaftliche Effizienz und kultureller Sinn. Wirtschaftliche Effizienz stiftet keine Gemeinschaft und vom kulturellen Sinn allein können wir nicht existieren.
Information
angezettelt. informationsblatt des sächsischen Literaturrates e.V.
www.saechsischer-literaturrat.de

Der Forschungsverbund der Archive Marbach-Weimar-Wolfenbüttel gibt die »Zeitschrift für Ideengeschichte« heraus. Eben erschien Heft XII/4 Winter 2018.
Die Thematik des Heftes ist mit »Keile« überschrieben. Eigentlich sind Keilschriften gemeint. Markus Hilgert, Altorientalist und Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder, und Martin Mulsow, Professor für Wissenskulturen der europäischen Neuzeit und Direktor des Forschungszentrums Gotha, leiten das Thema ein: »Können Ideen verloren gehen? Einfach vergessen werden, und mit ihnen ganze Kulturen? Oder setzen und schreiben sie sich immer fort, und sei es als Flaschenpost? Wie unterscheiden sich eine ‹Ideenkultur› um 2000 v. Chr. von unserer? Was vergeht, wenn heute Keilschrift-Archive oder Inschriften zerstört werden? Diese Fragen werden selten gestellt. Denn unser Bildungskanon stammt aus einer Zeit, als die ägyptischen Hieroglyphen und die babylonische Keilschrift noch unentziffert und diese Kulturen damit unzugänglich waren. Man hat versäumt, ideengeschichtliche Fragen mit aller Selbstverständlichkeit bei diesen frühen Kulturen beginnen zu lassen. Wir heben immer noch mit Thales an, mit Homer oder Platon, wenn wir uns über den Verlauf des Denkens klar werden wollen. Warum nicht mit Esagil-kin-apli, der im 11. Jahrhundert vor Christus lebte, oder mit dem noch älteren Sinleqe-unnini?« (S. 4)
Ja, was sind die Ursachen für diese Beschränktheit heutiger westlicher Wissenschaft?
Zu Wort kommen der Herausgeber des Gilgamesch-Epos Stefan M. Maul, der über Zeichenlehre in Mesopotamien berichtet. Mit dem Bezug auf ein Heinrich-Heine-Gedicht versucht er die Fixierung auf die altestamentarische Babylon-Verurteilung zu verdeutlichen. Maul verweist auf die Biblithek in Ninive, in der der assyrischen König Assurbanipal (668–631 v.u.Z.) das gesamte enzyklopädische Wissen der Zeit zusammentragen ließ (S. 10).
Sein Fazit: »Das Erforschen der Zeichenhaftigkeit der Welt stand für die Gelehrten Mesopotamiens im Dienste der Divination, die heute als Aberglaube gilt. Über eine solche Wertung wird alzuleicht vergessen, dass im Alten Orient mit der Divination eine Idee Gestalt annahm, die – in bisweilen fataler Weise – unsere Gesellschaft bis heute bestimmt: nämlich die Vorstellung, dass die gesamte Welt einem Gefüge von strengen Gesetzmäßigkeiten unterworfen sei …« (S. 20).
Es folgen Artikel von Manfred Krebernik über das Verhältnis von Keilschrift und Alphabet, ein Gespräch von Markus Hilgert und Martin Mulsow mit dem Schriftsteller Raoul Schrott, ein Artikel von Reinhard G. Lehmann über den Altorientalisten Friedrich Delitzsch und seine Vortragsreihe »Babel und Bibel« von 1902/1903 und ein Artikel von Michael Weichenhan über die Gilgamesch-Rezeption um 1900.
Die Beiträge lesen sich alle sehr interessant. Aber die Eingangs gestellten Fragen von Hilgert und Mulsow werden damit nicht beantwortet. Vielleicht, weil die Aufgabe zu groß für eine solche Publikation war? In der Tat gehörte es lange zum wissenschaftlichen Standard, unpassende Beiträge mit dem Verdikt »vormodern« vom Diskurs auszuschließen. »Die Moderne«, die westeuropäisch-amerikanische Kultur war das Kriterium der Wahrheit. Wer daran zweifelte, der wurde als »Kulturrelativist« beschimpft.
Warum aber wurde von den Herausgebern nur ihre Spezialdisziplin angeführt und nicht auf die lange deutsche Forschungstradition in Sachen Orient verwiesen?
Im 18. Jahrhundert waren viele Alttestamentler studierte Orientalisten. Michaelis und Eichhorn seien genannt. (vgl. Smend, Rudolf: Deutsche Alttestamentler in drei Jahrhunderten. Göttingen 1989)
Gottfried Wilhelm Leibniz und Johann Gottfried Herder nahmen die Berichte der Jesuiten und der französischen und britischen Gelehrten aus Persien, Indien und China begeistert auf. Die Religion war über Jahrhunderte und Jahrtausende die Hüterin der Tradition und damit auch der Wissenschaft schrieb Johann Gottfried Herder.
Das Fazit von Stefan Maul verdeutlicht indirekt die Ursache für die Hypertrophierung von Wissenschaft und der Vernachlässigung mündlicher und religiöser Überlieferungen: im neuzeitlichen Westeuropa trennt man Wissenschaft und Glauben.
Im Orient ist die Einheit der Gegensätze von Wissen und Glauben in der Weisheit dagegen bis heute üblich.
Herder hob den inneren Zusammenhang der Menschheitsreligionen hervor. Es gehe um die »Urerzählung der Schöpfung«, die von den verschiedenen Nationen je auf besondere Weise weitererzählt und weitergegeben wurde. Hermann Gunkel, Hugo Greßmann und vielen anderen führten den Herderschen Ansatz 100 Jahre später im Projekt der »Religionsgeschichte« weiter. Zahlreiche Zeitschriftenartikel und Monographien liegen vor. Ein Forschungsfazit, die Enzyklopädie »Religion in Geschichte und Gegenwart« aus dem Mohr Siebeck Verlag, setzte bereits in der ersten Auflage von 1909 Maßstäbe, an denen sich auch heutige Wissenschaft messen lassen muss.
Information
Zeitschrift für Ideengeschichte.
Die gedruckte Ausgabe erscheint viermal jährlich im C.H. Beck Verlag in München.
www.z-i-g.de

Liebe Leserinnen und Leser, wir haben Ihnen ohne Frage einige Anstrengung zugemutet, hoffen aber, dass wir auch Vergügen bereiteten. Erstens müssen wir die Zusammenhänge unseres Lebens versuchen zu erkennen, wenn wir nicht wie der Spezialist enden wollen, der von immer weniger Dingen immer mehr weiß, und der zum Schluss von NICHTS alles weiß. Zweitens gibt es ohne Anstrengung für uns Menschen kein Vergnügen.
Johannes Eichenthal
