Die Stadt Görlitz ehrt ihren großen Sohn Jacob Böhme (1575–1624), anlässlich seines 400. Todestages, seit Beginn des Jahres 2024 mit einer großen Zahl vielfältigster Veranstaltungen. Der Verein Ideenfluss e.V. und das Schlesische Museum führen zahlreiche und unterschiedliche Akteure zusammen. So kann der Interessierte Vorträge, Lesungen, Konzerte, Ausstellungen, Kunstaktionen u.a. besuchen. Dazu kommt, dass Jacob Böhme, dessen einstiges Wohnhaus an der Neiße sich heute auf der polnischen Seite von Görlitz/Zgorzelec befindet, beide Länder mit gemeinsamen Veranstaltungen verbindet.

Grundlegende Informationen für die, die ihr Wissen über Jacob Böhme auffrischen möchten, bietet das Schlesische Museum mit der Ausstellung »Lilienzeit – der mystische Philosoph Jacob Böhme und die Erneuerung der Welt«. Hier werden biografische Informationen mit originalen Schriften von Böhme und seinem Umfeld ergänzt. Die Erstfassung des Berühmten Werkes »Aurora – Morgenröte im Aufgang …«, mit dem Böhme seine Publikationstätigkeit begann, ist leider nicht mehr im Original präsentierbar. An deren Statt findet der Besucher im Eingangsbereich der Ausstellung einen Bildschirm. Hier kann man durch die digitalisierte Fassung der Handschrift blättern. Einzelne Passagen werden in lesbarer Transkription wiedergegeben. Allein dieses Exponat lohnt den Besuch der Ausstellung.

Der 19. Oktober, ein Sonnabend, war ein sonniger Herbst-Tag. In Görlitz an der Neiße wehte ein frischer Wind. Der Verein Ideenfluss e.V. und das Schlesische Museum hatten um 10.30 Uhr gemeinsam zu einem Vortrag im Rahmen des Jacob-Böhme-Programms eingeladen. Der Eingang zum Vortragssaal lag direkt gegenüber dem Eingang zur Lilienzeit-Ausstellung. Der großzügig eingerichtete, lichte Vortragssaal verfügte über eine große Leinwand zur Bildwiedergabe.

Frau Dr. Martina Pietsch, die Vertreterin des Schlesischen Museums, begrüßte voller Freude die zahlreich erschienenen Gäste und stellte den Referenten Dr. Andreas Eichler vor. Dieser bedankte sich bei Frau Dr. Pietsch und dem Schlesischen Museum für die gute Zusammenarbeit bei der Veranstaltungsvorbereitung. Ebenso dankte er Frau Birgit Beltle, die ebenfalls erschienen war, und dem Verein Ideenfluss e.V., für die Einladung und die Aufnahme in Görlitz.

Andreas Eichler hob zunächst hervor, dass er Jacob Böhme im Zusammenhang der Überlieferung darstellen und gleichzeitig Hinweise vermitteln wolle, wie man selbst Zusammenhänge der Überlieferung in der Sprachlandschaft Mitteldeutschland, der Region zwischen Braunschweig und Görlitz, erfassen könne. Diese Annäherung ähnle einer Wanderung durch die Sprachlandschaft Mitteldeutschland. Voraussetzung des Gelingens seien: 1. Eine weite Literaturauffassung, die auch Wissenschaft und Technik einschließe, und 2. Philosophie als Weisheit, um den Zusammenhang in Chaos und Trümmern der Geschichte zu erfassen, und um gezielt lesen zu können. In den Lexika werde Philosophie als »Liebe zur Weisheit« definiert. Im Nachfolgenden komme aber nur noch Vernunft vor. Eichler betonte, dass seit Jahrtausenden in allen Religionen und Kulturen Weisheit als Einheit der Gegensätze Glaube und Vernunft verstanden werde. Die »Liebe zur Weisheit« schließe die Inbesitznahme von Weisheit aus. Deshalb spreche man besser bei Philosophie als einer »Suche nach Weisheit«. Alle modischen Zuschreibungen (kritisch, modern, mystisch, rational usw.) seien vernachlässigbar. Philosophie ist seit Jahrtausenden die Suche nach Weisheit. Eichler verwies weiter darauf, dass er am Medium Buch anknüpfe. Das Buch ermögliche den individuellen Zugang zum sprachlich-literarischen Erbe. Ein Kanon sei für den Leser ohne Bedeutung. Schließlich verwies er darauf, dass es in seiner Darstellung ausschließlich um den Text der Autorinnen und Autoren gehe, nicht um deren Gesinnung, politische Überzeugung oder sexuelle Orientierung. Der Text entfalte nach der Veröffentlichung ein Eigenleben und darum gehe es.

Jacob-Böhme-Denkmal in Görlitz (Aus: Literarische Wanderung durch Mitteldeutschland, Teil 1)
Eichler stellte einige Vorläufer des in deutscher Sprache publizierenden Jacob Böhme vor (Heinrich von Veldecke, Mechthild von Magdeburg, Meister Eckhart, Valentin Weigel und Wolfgang Ratke). Dann kam er endlich auf den von den Görlitzer Zuschauern lange erwarteten Jacob Böhme zu sprechen. Der wurde in der Zeit der Auseinandersetzung zwischen katholischem Kaisertum und landesfürstlichem Protestantismus geboren. Ernst-Heinz Lemper habe die konkrete Situation in seiner 1976 erschienen Böhme-Biographie konkret dargestellt. Eichler hob auch die Bemerkung von Hermann Pältz, dem Herausgeber einer Auswahl von Böhme-Texten aus dem Jahre 1957, hervor, der auf die Rolle der Handwerker-Werkstatt für die Denkentwicklung aufmerksam gemacht hatte. Die Tätigkeit mit unseren Händen werde heute als wesentlicher Einflussfaktor unserer Denkentwicklung anerkannt.

Wohnhaus Jacob Böhmes am rechten Neiße-Ufer (3. v. li., aus: Literarische Wanderung durch Mitteldeutschland, Teil 1)
Weiter erinnerte der Referent an die Bedeutung Schlesiens als einem literarischen Zentrum des deutschen Reiches im 17. Jahrhundert, die Kontakte einiger Görlitzer Bürger zu Paracelsus, Valentin Weigel, Tycho Brahe und Johannes Kepler. In Bezug auf eine Pragreise Böhmes hob Eichler hervor, dass Kaiser Rudolf II. viele große Wissenschaftler nach Prag geholt habe, u.a. Tycho Brahe und Johannes Kepler. In den Aufzählungen der Prager Wissenschaftler werde in der Regel der in Annaberg geborene Lazarus Ercker, der Begründer der analytischen Chemie im Montanwesen, vergessen.
Eichler fügte an, dass Kepler, Brahe und Ercker eine Wissenschaftsströmung vertraten, die das überlieferte Erbe mit der Suche nach neuen Erkenntnissen und neuen Messverfahren verbinden konnte. Zu dieser Strömung gehörten auch die naturforschenden Ärzte, wie Paracelsus und Agricola.
Gleichzeitig entstand in dieser Zeit aber eine Richtung in der Naturwissenschaft, die mit aller Tradition brach und ausschließlich die neuen Messverfahren schätzte. Galileio Galileis Grundsatz lautete: Was nicht quantifiziert ist, existiert nicht.

Die Aurora-Schrift Jacob Böhmes sei bereits ein Jahr nach dem Erscheinen verboten worden. Die Ursache des Verbotes sei im Zustand der evangelischen Landeskirche zu suchen. Luther hatte mit der Bibelübersetzung in die deutscher Sprache nicht nur das Frühneuhochdeutsche begründet sondern machte den Text auch für Nicht-Theologen lesbar und nachvollziehbar. Aber die Nachfolger des Reformators waren in eine orthodoxe Staatskirche zurückgekehrt, in ähnliche Strukturen wie von Jesuiten vorangetriebene Gegenreformation. Beide beanspruchten ein Monopol auf die buchstäbliche Auslegung des Bibeltextes.
Böhme vertrat dagegen eine nichtinstitutionelle Religiösität, ein nichtinstitutionelles Christentum gegen erstarrte Strukturen. Allein seine Beschäftigung mit dem Text der Bibel, noch ehe das Manuskript entstand, war aus orthodoxer Sicht ein Vergehen.

Porträt Jacob Böhme
Aber der 1612 erschienenen Titel »Aurora« stellte eine Verbindung zu Morgendämmerung und Hoffnung her. Die Hoffnung, dass unser Leben einen Sinn hat, so Eichler, ist aber der Kern des Glaubens. So hatte der Text von Anfang an eine hohe Anziehungskraft.
Für einen interessierten Laien ist der Aurora-Text aus unserer Zeit nicht leicht verstehbar. Aber alle überlieferten Texte aus vergangenen Jahrhunderten und Jahrtausenden sind für uns erst einmal fremd. Im Abstand von 400 Jahren ist nicht mehr alles verstehbar. Dennoch müssen wir versuchen einen Zugang zum ganzen Text und seinen 27 Kapiteln zu finden.
Eingangs bezeichnet sich Böhme als »einfältigen« Autor, der keine Universität besucht und die Natur studierte. Diese Form von Bescheidenheit ist heute ungewohnt. Aber einige Seiten später präsentiert Böhme die neue Erkenntnis, dass wir die Welt mit allen Sinnen erkennen, nicht nur mit dem Kopf, dass Sprache/Vernunft/Verstand den inneren Zusammenhang aller Sinneswahrnehmunge herstellen: »Nun halten die 5 Sinne immer rath in krafft des gantzen Leibes/ und wen der rath beschlossen ist/ so spricht es der zusammengefuegte Richter aus in seinem centro, oder in die mitten des Leibes als ein Wort/ in das hertz/ dan das ist aller kraeffte quellbrun/ von dem es auch sein aufsteigen nimmt.«
Diese Position, so Eichler, sei später von Leibniz und Herder aufgenommen worden.
Bei der Lektüre wird deutlich, dass Böhme mit der Wortbildung rang, um unbekannte Zusammenhänge zu erfassen und kommunizierbar zu machen. Der Text deute darauf hin, dass Böhme beim Schreiben intensiv nachgedacht habe, dass er wenig Möglichkeiten hatte, seine Gedanken mündlich vorzutragen.
Typisch seien Wortbildungen und -erklärungen, wie »Qualität«: treibende Kraft, Quellkraft, Gott als Quellkraft der Quellkräfte: »Gott ist das Hertze oder Quelbrunn der Natur/auß ihm ruehret her Alles.« (S. 49)
Böhme habe Gott nicht mehr personalisiert, sondern als »die Kraft der Kräfte« im Universum bestimmt. Hier knüpften Leibniz und Herder mit dem Begriff der »organischen Kraft«, des »organischen System« ebenfalls an. In diese Sichtweise passt auch, dass Böhme den Schöpfungsprozess als »Formiren« (die Bewegung der Form, des Wesens eines Systems) bezeichnet. Der Begriff geht auf Aristoteles zurück und ist geeignet die Entwicklung organischer Kräfte, organischer Systeme fassbar zu machen.
Ab dem 22. Kapitel sei der Text ein Kommentar des Alten Testaments, der Bücher Moses. Böhme versucht mit hermeneutischen Methoden den Sinn des Textes zu erschließen, nicht bei der Bedeutung der Buchstaben stehenzubleiben. Dabei konstatiert er, dass Moses bei den geschilderten Ereignissen nicht zugegen gewesen sein könne. Er versucht den Sachverhalt damit zu erklären, dass ihm mündliche Überlieferungen zur Verfügung standen. Hier fügte Eichler ein, dass Johann Gottfried Herder bereits Ende des 18. Jahrhunderts auf Forschungsergebnisse der Orientalisten zurückgreifen konnte, dass Moses auch nicht der Autor der Bücher Moses gewesen sei. Heute werden diese Texte in Bibelausgaben nur als »Genesis« bezeichnet.
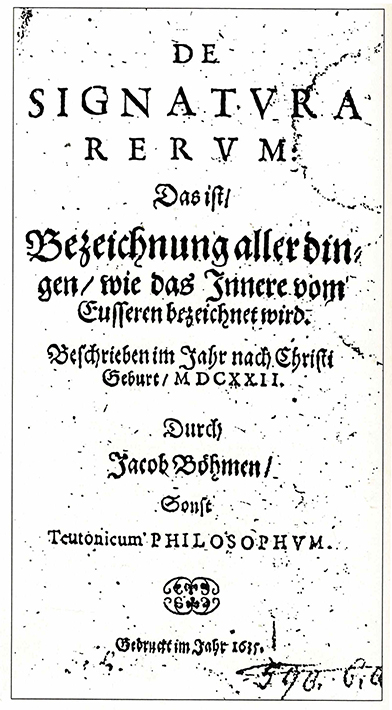
Jacob Böhme habe den Leser darauf verwiesen, dass das Lesen in der Bibel und das Lesen im Buch der Natur vergleichbar seien: Naturerkenntnis sei Gotteserkenntnis. Auch in dem späterem Werk »De Signatura rerum« habe Böhme die Metapher von der Natur als ein aufgeschlagenes Buch ausdrücklich hervorgehoben. Seine Schlussfolgerung sei gewesen, dass man die Sprache der Natur verstehen müsse, um die Buchstaben und Zeichen lesen zu können. Mit dem Begriff der »Signatur« habe Böhme den »Abdruck des göttlichen Wesens in der Natur« bezeichnet. Dies sei kein »Pantheismus«. Der Begriff gehe auf neuplatonische Einflüsse zurück. Auch bei Meister Eckhart und Herder sei dieser Begriff zu finden.
Böhme habe den Begriff Signatur/Bezeichnung auf Zeichen in der Natur und auch zur Bezeichnung der Sinneseindrücke in der Sprache angewendet. Das habe Ernst-Heinz Lemper 1976 vorbildlich nüchtern dokumentiert. Die Konsequenz aus Böhmes Gedanke habe Herder gezogen. Die bezeichnende Sprache ist nicht eine Eigenschaft des Menschen unter anderen, sondern die bezeichnende Sprache sei die Disposition des Menschen: wir konstituieren uns als Menschen in der bezeichnenden Sprache und nicht in Bewusstsein.

Grab Jacob Böhmes in Görlitz (Aus: Literarische Wanderung durch Mitteldeutschland, Teil 1)
Eichler fügte an, dass der Druck der Werke Böhmes in den Niederlanden große Auswirkungen hatte. Die Übersetzung ins Englische erfolgte durch den Cambridge-Gelehrten Charles Hotham, den Lehrer John Miltons. Die englische Ausgabe stellte die Grundlage für die internationale Wirkung der Philosophie Böhmes dar.
Abschließend fasste Eichler zusammen, dass Böhme verschiedene Denkströmungen vereinigt und ein reflexions- und assoziationsreiches Werk schuf. Der Text habe über die Jahrhunderte immer wieder Leser zu eigenem Nachdenken angeregt. Diese Eigenschaft sei ein Indiz für die literarische Qualität des Textes.

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716)
Im Anschluss stellte Eichler die Nachfolger Böhmes Gottfried Wilhelm Leibniz und Johann Gottfried Herder vor. Beide kannten die Werke von Paracelsus, Weigel und Böhme, zitierten diese aber nicht, um nicht als »heterodox« oder »schwärmerisch« aus dem wissenschaftliche Diskurs ausgeschlossen zu werden. Der große Logiker Leibniz habe in seinen Thesen »In der Vernunft begründete Prinzipien von Natur und Gnade« festgestellt, dass man organische Systeme nicht auf rein empirisch, quantifizierendem Wege erfassen könne. Man benötige ein Gegeneinander von Induktion und Deduktion. Man müsse vom Einzelnen ausgehen, jedoch gleichzeitig vom Ganzen.

Johann Gottfried Herder (1744–1803)
Johann Gottfried Herder habe die von Leibniz entwickelte Methode fortgesetzte. Herders »Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit« seien der Bestimmung des Platzes des Menschen im Kosmos gewidmet. Man stoße in diesem Text mitunter auf die wörtlichen Böhme-Zitate.

Selbstbildnis Walther Rathenau (1867–1922)
Auch Walther Rathenau, Eichler nannte ihn den »Leibniz des 20. Jahrhunderts«, habe Böhme, Leibniz und Herder weitergeführt. Noch heute werde er als »Mystiker« und »Mystizist« verunglimpft, um ihn vom wissenschaftlichen Diskurs fernzuhalten. In seiner Analyse habe Rathenau herausgearbeitet, dass die Verbindung von Industrie und Effizienzstreben die ganze Menschheit zu einer Art von Maschine zwangsverbunden habe. Dieser Prozess, den er »Mechanisierung« nannte, sei eine materielle Gewalt.

Ricarda Huch (1864–1947)
Ricarda Huch habe einen anderen Aspekt dieses Prozesses ergänzt. Die Dominanz des bloß quantifizierenden Verfahrens, habe den Eindruck erweckt, als sei die Natur etwas »neben« dem menschlichen Leben. Daraus sei eine schleichende »Entpersönlichung« des Lebens der Industrieländer und eine wachsende Verantwortungslosigkeit hervorgegangen.
Eichler hob hervor, dass der von Huch und Rathenau beschriebene Prozess letztlich die Dominanz der bloß finanziellen Effizienz hervorbrachte. Rathenau habe drauf verwiesen, dass gleichzeitig ein Drittel der Industrieproduktion überflüssig sei (Kitsch, Ramsch, Luxus). Auch ein Drittel der Lebensmittel wird in den Industriestaaten vernichtet. Was bloß finanziell effizient ist, so Eichler, sei sozial ineffizient.
Rathenau habe hervorgehoben, dass sich der individuelle Mensch gegen materielle Gewalt der Mechanisierung nur mit geistigen Kräften behaupten könne. Weder dogmatischer Sozialismus, noch Kirchen oder akademische Intellektualphilosophie seien aber dafür geeignet. Vielmehr bedürfe es einer geistigen Prophetie und der Stärkung unserer Seelenkräfte. Der letzte Satz seines philosophischen Hauptwerkes »Von kommenden Dingen« lauten: »Wir sind nicht da um des Besitzes willen, nicht um der Macht willen, auch nicht um des Glückes willen; sondern wir sind da zur Verklärung des Göttlichen aus menschlichem Geiste.« Wir sind da, so Eichler, um unseren Platz im Naturkreislauf, im Kosmos zu begreifen.
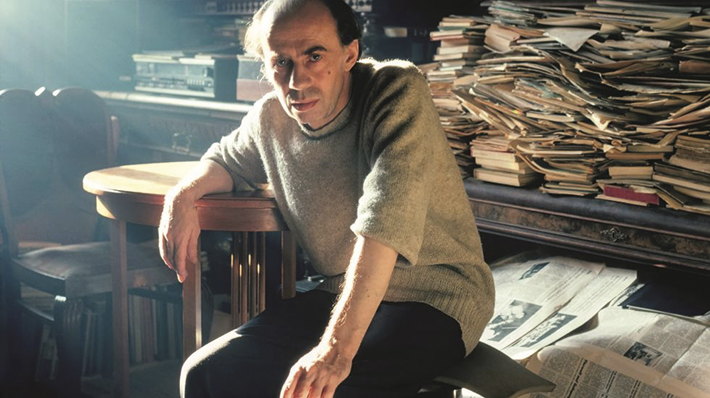
Carlfriedrich Claus (1930–1998)
Eichler verwies auf die Nachfolge des in Annaberg-Buchholz geborenen Künstlers Carlfriedrich Claus. Der hatte 1977 eine Grafikmappe mit dem Titel »Aurora – Morgenröte im Aufgang« und zehn Grafiken mit kurzen Textzitaten versehen. Er fasste das 60. Jubiläum der Russischen Revolution als Teil eines Aufbruch der Völker Asiens, Afrikas und Lateinamerikas aus nationaler und kolonialer Unterdrückung. Zugleich hob er hervor, dass die Menschheit eines anderen Verhältnisses zur Natur, einer anderen Industrie und Technik bedürfe. In einem Interview zur Ausstellung der Grafiken nannte er zur Erklärung die Gaia-Hypothese. Dies wurde in einer 1974 in Stockholm erschienene Zeitschrift von Lynn Margulis und James Lovecraft aufgestellt. Die These besagt, dass die Erde ein selbstregulierendes System ist und ein Lebewesen sein könnte. (Die beiden Autoren hatten keine Kenntnis von Johann Gottfried Herders Werk.)
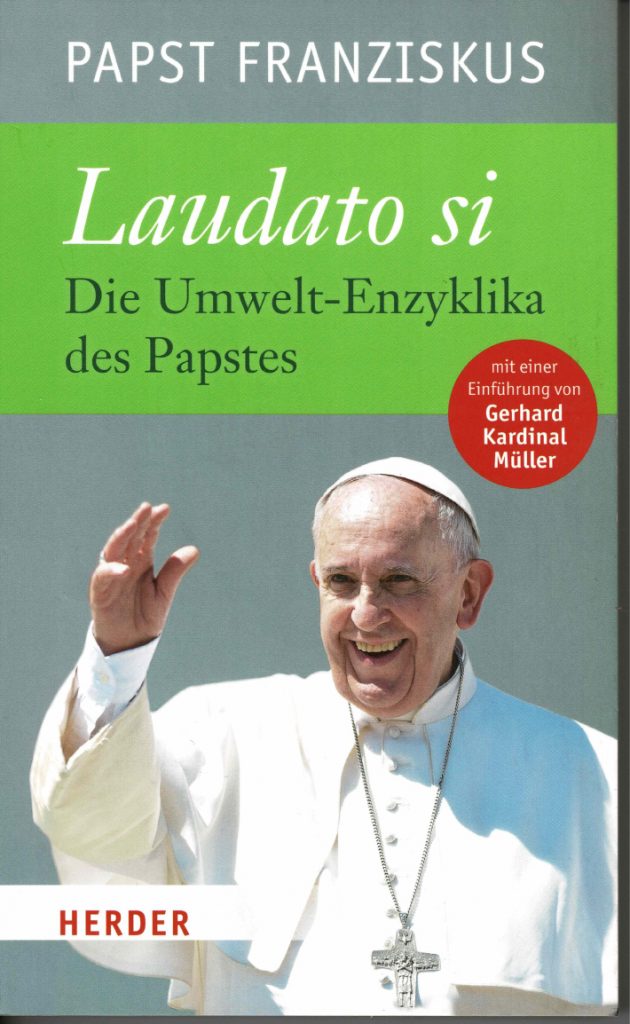
In seiner Zusammenfassung verwies Eichler auf die Umweltenzyklika von Papst Franziskus aus dem Jahre 2015. Der Papst habe festgestellt, dass Wirtschaft, Politik und Wissenschaft über kein Bild vom Naturkreislauf verfügen. Wissenschaft und Politik hätten keines, weil sie die Natur immer noch beherrschen wollten. Die Wissenschaft gefalle sich in ihrer Überspezialisierung und ihren Methoden. Die bloß quantifizierende Logik, so Eichler, vermöge nur Folgerichtigkeit darzustellen, keine lebenden Systeme als Ganzes zu erfassen. Man habe damit jede Menge moderne Messverfahtren entwickelt. Mit der Computertechnik würden Stärken und Schwächen dieser bloß quantifizierenden Logik verstärkt. Schon Kant habe festgestellt, dass man mit dieser Logik sowohl »beweisen« könne, dass die Welt einen Anfang habe als auch, dass sie keinen Anfang habe. Kant habe die Ursache in der Wirklichkeit vermutet, nicht in seiner Methode. Heute sei es möglich jedes »wissenschaftliche Gutachten« mit einem anderen wissenschaftlichen Gutachten, dass zur gegenteiligen Auffassung komme, zu neutralisieren. Man ziehe sich dann hinter die Formel zurück, dass der Forschungsprozess noch nicht abgeschlossen sei, um so weiter machen zu können, wie bisher.

Aber man könne nicht so weitermachen, wie bisher, so Eichler. Die Wiedereinordnung der Menschheit in den Naturkreislauf sei eine Frage der Existenz geworden. Die Forschung müsse beim Einzelnen ansetzen und gleichzeitig beim Naturganzen. Das Naturganze sei aber mit rein quantifizierenden Methoden nicht adäquat erfassbar. Das Methodensystem müsse ergänzt werden durch Intuition, Gebet und Meditation. Man müsse sich all das Wissen wieder aneignen, das man in Europa 500 Jahre lang als »Aberglaube«, »Mystik«, »Vorwissenschaft«, »Vormodern« u.a. verdrängt habe. Auch der Weg der sprachlich-literarischen Überlieferung, die Schriften Jacob Böhmes gehören dazu. Der Reichtum der Religionen und Kulturen der Völker Afrikas, Asiens und Lateinamerikas, den man vom Standpunkt »okzidentaler Rationalität« ignoriert habe, rücke wieder in den Blick: »Wenn wir die Komplexität der ökologischen Krise und ihrer vielfältigen Ursachen berücksichtigen, müssen wir zugeben, dass die Lösung nicht über einen einzigen Weg, die Wirklichkeit zu interpretieren und zu verwandeln, erreicht werden kann. Es ist auch notwendig, auf die verschiedenen kulturellen Reichtümer der Völker, auf Kunst und Poesie, auf das innerliche Leben und auf die Spiritualität zurückzugreifen. Wenn wir wirklich eine Ökologie aufbauen wollen, die uns gestattet, all das zu sanieren, was wir zerstört haben, dann darf kein Wissenschaftszweig und keine Form der Weisheit beiseitegelassen werden, auch nicht die religiöse mit ihrer eigenen Sprache.« (Papst Franziskus: Enzyklika Laudato Si’. Sorgen über das gemeinsame Haus, Rom 2015, S. 47)

Kommentar
Andreas Eichler hatte sich vielleicht wieder einmal etwas zu viel vorgenommen. Der Inhalt des Vortrages hätte sicher für mehrere »normale« Veranstaltungen ausgereicht. So war es für die Besucher vielleicht doch nicht ganz einfach, dem Vortrag zu folgen. Andrerseits spannte er einen Bogen über 800 Jahre Literatur-, Sprach- und Denkgeschichte. Wer befasst sich heute noch mit einem solchen Zeitraum? Dazu bot er jede Menge Querverbindungsanregungen. Und er hatte am Ende auch großes Glück. In der Diskussion wurde deutlich, dass sich ein sehr engagiertes Publikum zusammengefunden hatte. Frau Beltle stellte zum Beispiel die Frage, ob nicht so etwas wie der Holocaust mit der industriellen Effzienz-Maschine, der mit der Quantifizierung verbundenen Entpersönlichung und Verantwotungslosigkeit erklärbar sei. Im Publikum befanden sich weitere Akteure, die selbst im Rahmen des Böhme-Gedenkjahres Veranstaltungen durchführen. Viele der Besucher hatten Jacob Böhme als einen Impulsgeber begriffen, den sie heute weiterführen möchten, um einen Beitrag zur Sicherung der Zukunft der Menschheit zu leisten. Man kann diese Szene, die in Görlitz herangewachsen ist, nicht hoch genug schätzen.
Den Organisatoren und den Besuchern ist für das Ereignis zu danken.
Clara Schwarzenwald
Information

Stadtplan Görlitz (Aus: Literarische Wanderung durch Mitteldeutschland, Teil 1)
Die Ausstellung »Lilienzeit« ist noch bis zum 2. Februar 2025 zu sehen. Zur Ausstellung liegt eine Begleitbroschüre vor, die durch die Ausstellung führt. Zum Preis von 2 Euro kann man die wichtigen Informationen zu den Exponaten auch mit nach Hause tragen.
Der Todestag Jacob Böhmes war der 16. November 1624.
Im Rahmen des Böhme-Gedenkjahres finden in Görlitz vom 14. bis zum 17. November noch einmal sehr viele Veranstaltungen statt.
Papst Franziskus: Enzyklika Laudato Si’. Sorgen über das gemeinsame Haus, Rom 2015: https://www.vatican.va/content/francesco/de/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
Die Bände 1 und 2 der Literarischen Wanderung durch Mitteldeutschland sind im Buchhandel oder direkt beim Verlag erhältlich:
Band 1. Von den Minnesängern bis Herder: https://buchversand.mironde.com/p/literarische-wanderung-durch-mitteldeutschland-von-den-minnesaengern-bis-herder-sprache-eigensinn1
Band 2. Von Goethe bis Rathenau: https://buchversand.mironde.com/p/literarische-wanderung-durch-mitteldeutschland-von-goethe-bis-rathenau-sprache-eigensinn-2-1
Der Band 3. Von Landauer bis Gundermann ist für April 2025 ist angekündigt
Die Litterata – Technik und Poesie in Mitteleuropa – ist ein Feuilleton des Mironde Verlags (www.mironde.com) und des Freundeskreises Gert Hofmann.


Dieser fulminante Text von Herrn Dr. Eichler wurde mir beim langsam-sorgfältigem Lesen plötzlich zu einem ganz persönlichem Trost. Danke, lieber Andreas! ich bin froh, Deine Frau und Dich zu kennen. Utz Rachowski
Es ist beeindruckend und anregend zugleich aber schwer zu erfassen für einen “ normalen “ Menschen diese Fülle an Informationen und verbindende Aussagen über viele Jahrhunderte und zugleich einen Bezug zur Gegenwart findend.
In bleibender Hochachtung und Verbundenheit
wünsche ich euch weiterhin viel Schaffenskraft
Reinhard